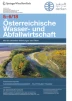Avoid common mistakes on your manuscript.

Das vorliegende Heft 11–12/2013 der Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaft spannt einen thematischen Bogen von aquatischen Indikatorgruppen wie Makrozoobenthos- und Fischfauna über Untersuchungen von Auenrevitalisierungen bis hin zu Fragen der Ökosystem-Funktionen von Flusslandschaften und der Bedeutung von Systemwissen als Beitrag für ein nachhaltiges Gewässermanagement. Dabei werden die genannten Fragestellungen anhand verschiedener Fallstudien in Österreich untersucht.
Der Beitrag „Das Makrozoobenthos als Indikatorgruppe zur Bewertung großer Flüsse unter Einbeziehung auenökologischer Aspekte“ dokumentiert die methodische Entwicklung eines anwendungsorientierten Auen-Index, basierend auf Libellen und Köcherfliegen als indikativen Makrozoobenthos-Ordnungen. Es galt zu überprüfen, ob Mollusken sowie weitere MZB-Gruppen integriert werden sollen. Dabei werden die z. T. sehr unterschiedlichen, sich jedoch ergänzenden hydrologischen Präferenzen der Indikatoren in idealer Weise genutzt, um die hydrologischen Ist-Zustände in einem Untersuchungsgebiet zu dokumentieren und mittels der Abweichung von Referenzzuständen zu bewerten.
Anhand des Beispiels der Lobau (Nationalpark Donau-Auen) werden „Potenzial und Grenzen von Auen-Revitalisierungen“ diskutiert. Im Rahmen der Untersuchungen werden verschiedene flussbauliche Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Revitalisierung der Wiener Lobau hinsichtlich ihrer Folgen für das Gebiet bezüglich einer verstärkten Dynamisierung der Auen dargestellt. Die Bandbreite der Maßnahmen reicht – je nach Gebietspotenzial – von einer kontrollierten Dotation (konservierender Ansatz) bis zu einer neuerlichen Anbindung des Altarmsystems an die Donau mit periodisch hohen Durchflüssen (Auenrevitalisiserung).
Ein weiterer Artikel über „Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassertemperatur und die Fischfauna in Flüssen unterhalb von Seen“ thematisiert ein hochaktuelles Problem v. a. auch in Zusammenhang mit zukünftigen Anpassungsstrategien im Gewässermanagement. Ziel dieser Arbeit war es, zu erkennen, welche Fischregionen bzw. Fischarten am stärksten von Wassertemperaturanstiegen betroffen sind und zu verstehen, welche Veränderungen bereits anhand vorliegender Daten zu beobachten sind.
Im Beitrag zur „Wahrnehmung von fließgewässerbezogenen Ökosystemleistungen und Konfliktpotenzialen“ wurden empirische Untersuchungen in der Flusslandschaft der Oberen Enns durchgeführt. Es zeigte sich, dass von unterschiedlichen Gruppen von AkteurInnen eine große Bandbreite an Ökosystemleistungen wahrgenommen wird. Die Ergebnisse lassen auf eine hohe Kooperationsbereitschaft und Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen im Fließgewässermanagement schließen.
Dem „Erfassen und Verstehen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen in Flusslandschaften“ widmet sich der abschließende Beitrag. Durch Vermittlung von Systemwissen an SchülerInnen im Rahmen eines „Sparkling Science-Projektes“ sollen diese als zukünftige BewohnerInnen und NutzerInnen von Flusslandschaften Zusammenhänge erkennen, Projektentscheidungen und Maßnahmen verstehen und nachhaltige Planungen unterstützen. Bereits nach dem ersten Schuljahr konnte die Zusammenarbeit WissenschafterInnen/PädagogInnen/SchülerInnen – neben größerem Faktenwissen – eine hohe Motivation der Jugendlichen an der Forschungsmitarbeit und großes Interesse an Fragen zu Umwelt und Natur dokumentieren.
ao.Univ.-Prof. DI Dr. Susanne Muhar
Universität für Bodenkultur Wien
Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Max-Emanuel-Straße 17, 1180 Wien
susanne.muhar@boku.ac.at
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Muhar, S. Fließgewässer, Ökologie. Österr Wasser- und Abfallw 65, 385 (2013). https://doi.org/10.1007/s00506-013-0121-3
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s00506-013-0121-3