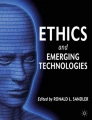Abstract
The following remarks describe the experiences of fighter pilots during World War I and the upcoming alteration of man-machine interfaces by the means of literary and historical examples. In this connection it will be explained that literature as a formation of knowledge doesn’t suffer a loss of schemes and structures, but, moreover, retains traditional rhetorical figures to handle new techniques of mechanical artefacts. In this case literature serves as a system to generate an arrangement of familiarity and acceptance of an unconversant technology.
Similar content being viewed by others
Literature
Ball, Hugo: Flucht aus der Zeit. München 1927 [1914], S. 6, zit. nach.
Ingold, Felix Philipp: Literatur und Aviatik. Europäische Flugdichtung 1909–1927. Frankfurt a. M. 1980, S. 215.
De Saint-Exupéry, Antoine: Nachtflug. Frankfurt a. M. 1951, S. 84.
Heraklit: »Fragment 50«. In: Die Vorsokratiker, Bd. 1. Hg. Jaap Mansfeld. Stuttgart 1983, S. 259.
Wagner, Birgit: Technik und Literatur im Zeitalter der Avantgarden: ein Beitrag zur Geschichte des Imaginären. München 1996, S. 120, 124.
Dass in der vorliegenden Analyse nur von dem singulären Aspekt der Mensch-Maschine- Verbindung auf die literarischen Texte geblickt und damit gleichzeitig bewusst alle anderen Zugänge (wie Versform, Figurenanalyse, Erzählstränge, etc.) ausgeblendet werden, die diese vielseitigen Werke natürlich ebenfalls hergeben, sei dem Forschungsthema geschuldet. Vgl. zur einführenden Lektüre Werber, Niels/ Kaufmann, Stefan/ Koch, Lars (Hg.): Erster Weltkrieg. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart/Weimar 2014.
Trischler, Helmuth: »Die neue Räumlichkeit des Krieges: Wissenschaft und Technik im Ersten Weltkrieg«. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 19 (1996), S. 95–103, hier: S. 95.
Zur Auswahl: Fritzsche, Peter: A Nation of Fliers. German Aviation and the Popular Imagination. Cambridge, Mass. 1992
Trischler, Helmuth/ Schrogl, Kai-Uwe (Hg.): Ein Jahrhundert im Flug. Luft- und Raumfahrtforschung 1907–2007. Frankfurt a. M. 2007
Bauer, Dieter R./ Behringer, Wolfgang (Hg.): Fliegen und Schweben. Annäherung an eine menschliche Sensation. München 1997
Behringer, Wolfgang/ Ott-Koptschalijski, Constance: Der Traum vom Fliegen. Zwischen Mythos und Technik. Frankfurt a. M. 1991.
Vgl. Posadowsky-Wehner, Arthur von: »Plädoyer des Grafen von Posadowsky-Wehner für eine Mobilisierung der deutschen Flugtechnik im Vorfeld des Ersten Weltkrieges (am 11.07.1912)«. In: Helmuth Trischler (Hg.): Dokumente zur Geschichte der Luft- und Raumfahrtforschung in Deutschland: 1900–1970. Frankfurt a. M./New York 1992, S. 47–50, hier: S. 47. Dazu auch
Böhme, Erwin: Briefe eines deutschen Kampffliegers an ein junges Mädchen. Hg. Von Johannes Werner. Leipzig 1930, S. 45 (15.08.1916). Hierbei muss natürlich die idealisierte Literarisierung der Kampfflieger mit betrachtet werden, siehe in Einbeziehung des Futurismus
Esposito, Fernando: Mythische Moderne: Aviatik, Faschismus und die Sehnsucht nach Ordnung in Deutschland und Italien. München 2011.
Böhme: Briefe eines deutschen Kampffliegers an ein junges Mädchen (wie Anm. 9), S. 46 ff. (15.08.1916). So auch Manfred von Richthofen, der von seiner »Jagdpassion« spricht, die er »beruhig[en]« muss (Richthofen, Manfred Freiherr von: Der rote Kampfflieger. Berlin/Wien 1917, S. 174).
Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt a. M. 2002, S. 212.
Siehe die Forderung nach stärkeren Motoren u. a. von Walter von Eberhardt (Oberst der Fliegertruppen), »Wie wir wurden (Tagebuchblätter aus dem Anfang des Weltkrieges)«. In: Georg Paul Neumann (Hg.): In der Luft unbesiegt. Erlebnisse im Weltkrieg erzählt von Luftkämpfern mit 6 Bildnissen. München 1923, S. 11–20, hier: S. 17.
Ich entlehne diesen Begriff bei Stéphane Vial: L’être et l’écran. Paris 2013.
Vgl. Schilling, Renè: »Kriegshelden«. Deutungsmuster heroischer Männlichkeit in Deutschland 1813–1945«. In: Krieg in der Geschichte. Paderborn 2002, Bd. 15, S. 39.
Jünger, Ernst (Hg.): Die Unvergessenen. Mit 4 Aquarellen und 64 Kunstdrucktafeln. München 1928, S. 12, vgl. dazu
Encke, Julia: Augenblicke der Gefahr. Der Krieg und die Sinne 1914–1934. München 2006, S. 59.
Richthofen: Der rote Kampfflieger (wie Anm. 12) S. 65; sowie Lübke, Anton: Oswald Boelcke der Meisterflieger. Reutlingen 1934, S. 49.
Ebd., S. 23. Dazu genauer Boelcke, Oswald: Hauptmann Bölckes Feldberichte. Gotha 1916, S. 26.
Kutz, Martin: »Das Flugzeug als Waffe–Der Erste Weltkrieg als Experimentierfeld des Luftkriegs«. In: Museum für Verkehr und Technik Berlin (Hg.): Hundert Jahre deutsche Luftfahrt. Lilienthal und seine Erben. Gütersloh 1991, S. 39–59, hier: S. 46.
Marinetti, Filippo Tommaso: »Zerstörung der Syntax. Drahtlose Phantasie. Befreite Worte (11. Mai 1913)«. In: Hansgeorg Schmidt-Bergmann (Hg.): Futurismus. Geschichte, Ästhetik, Dokumente. Reinbek bei Hamburg 1993, S. 210–220, hier: S. 211; In gleicherweise ließe sich, wenn auch mit anderen Schwerpunkten
Gabriele D’Annunzio: Vielleicht, Vielleicht auch nicht. München 1989 anführen.
Vgl. Hillebrand, Bruno (Hg.): Nietzsche und die deutsche Literatur. München 1978.
Es zeigt sich ein dreiteiliges Aufbauschema bei traditionellen Fliegerromanen: Fluggeschehen–Liebeshandlung–Fluggeschehen (vgl. Wagner: Technik und Literatur im Zeitalter der Avantgarden (wie Anm. 4), S. 122). D’Annunzio greift bei seiner Zeichnung der technischen Charakter und Flugzeugszenen auf traditionelle Texterstellung einer Mythopoiesis zurück (ebd., S. 104). Die Fliegerromane generieren (sehr konventionell) dabei einen Held zwischen »bestrafter Hybris« und »Selbstopferung« (ebd., S. 96, vgl. Kühn, Dieter: Luftkrieg als Abenteuer. Frankfurt a. M. 1987).
Holl, Ute: »Space Oddity 1926: Faust, Film, Flug«. In: Peter Berz (Hg.): FAKtisch: Festschrift für Friedrich Kittler zum 60. Geburtstag. München 2003, S. 123–135, hier: S. 130.
De Saint-Exupéry, Antoine: »Flug nach Arras«. In: Ders.: Romane. Dokumente. Düsseldorf 1966, S. 325–503, hier: S. 346
Vgl. Asendorf, Christoph: Super Constellation–Flugzeug und Raumrevolution. Die Wirkung der Luftfahrt auf Kunst und Kultur der Moderne. Wien/New York 1997, S. 191 ff.
Gerathewohl, Siegfried Johannes: Die Psychologie des Menschen im Flugzeug. München 1953, S. 138 ff.
Von Schrötter, Hermann: Hygiene der Aeronautik und Aviatik. Wien/Leipzig 1912, S. 92. Zur prothetischen Verlängerung des Körpers durch das Flugzeug im Futurismus Ingold: Literatur und Aviatik (wie Anm. 12), S. 291 ff.
Fuchs, Otfried: »Aus dem Tagebuch des Leutnant F.«. In: Neumann (Hg.): In der Luft unbesiegt (wie Anm. 15), S. 186–187, hier: S. 186 (Mai 1918).
Jünger, Ernst: Das Wäldchen 125. Berlin 1925, S. 19.
Ders.: »Vorwort« zu Luftfahrt tut not!. Leipzig/Nürnberg 1928. In: Ders.: Politische Publizistik. 1919–1933. Hg. Von Sven Olaf Berggötz, Stuttgart 2001, S. 397–407, hier: S. 404.
Ders.: »Das abenteuerliche Herz. Erste Fassung«. In: Ders.: Essays III. Das abenteuerliche Herz. Stuttgart 1979, S. 25–176, hier: S. 154, sowie Baumgarth, Christa: Geschichte des Futurismus. Reinbek bei Hamburg 1966.
Im Flugzeugunfall des Futurismus ereignet sich kein Unglück im herkömmlichen Sinne, sondern das Paradigma den Piloten als Übermenschen im Tod heilig zu sprechen (vgl. Schmidt-Bergmann, Hansgeorg: »Mafarka le Futuriste. F.T. Marinettis Literarische Konstruktion des futuristischen Heroismus«. In: Filippo Tommaso Marinetti: Mafarka der Futurist. Afrikanischer Roman. München 2004, S. 261–284).
Kafka, Franz: »Die Aeroplane von Brescia«. In: Ders: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Drucke zu Lebezeiten. Hg. Wolf Kittler/ Hans-Gerd Koch/ Gerhard Neumann. Frankfurt a. M. 1994, S. 401–412, hier: S. 407.
Die Technisierung des Fliegens, die sich hier schon andeutet, wird später durch mediale Automatisierung im Cockpit den Menschen fast gänzlich ausgliedern (vgl. Kaufmann, Stefan: Kommunikation und Kriegsführung, 1815–1945. München 1996, S. 344, 348).
Inwieweit der Begriff des Hybriden hier zu unspezifisch gebraucht wird, und es differenzierter »Pfropfung« nach Uwe Wirth genannt werden sollte, kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden (vgl. Wirth, Uwe (Hg.): Impfen, Pfropfen, Transplantieren. Berlin 2011
Ette, Ottmar/Ders. (Hg.): Nach der Hybridität. Zukünfte der Kulturtheorie. Berlin 2014).
Wegener, Georg: Der Wall von Eisen und Feuer. Ein Jahr an der Westfront. Leipzig 1915, S. 369 ff.
Guattari, Fèlix: »Über Maschinen«. In: Henning Schmidgen (Hg.): Ästhetik und Maschinismus. Texte zu und von Félix Guattari. Berlin 1995, S. 115–132, hier: S. 117.
Flusser, Vilèm: Vom Subjekt zum Projekt. Frankfurt a. M. 1998, S. 145.
Rheinberger, Hans-Jörg: Rekurrenzen. Texte zu Althusser. Berlin 2014, S. 160.
Barthes, Roland: »Der Jet-Man«. In: Ders.: Mythen des Alltags, Frankfurt a. M. 2010, S. 121–123, hier: S. 121.
Hegel definiert den Knecht als Bewusstsein, »welches nicht rein für sich, sondern für ein anderes, das heißt, als seyendes Bewußtseyn oder Bewußtseyn in der Gestalt der Dingheit ist (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Gesammelte Werke, Bd. 9. Hg. Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede. Hamburg 1980, S. 112). Für eine intersubjektive Betrachtung dieses Themas siehe
Bedorf, Thomas: Andere. Eine Einführung in die Sozialphilosophie. Bielefeld 2011, S. 71–80. Zu einem weiteren Aspekt der Kollektivleistung, die gegen eine heroische Individualisierung gerichtet ist, kann auch Brechts Lehrstück und sein Ozeanflug gerechnet werden. Hierbei nimmt Brecht eine Position gegen ritterliche Fliegerhelden und für ein Ingenieur-Kollektiv ein. Fliegen ist damit als Teamleistung zu verstehen
(Brecht, Bertolt: »Der Ozeanflug«. In: Ders.: Gesammelte Werke. Frankfurt a. M. 1967, Bd. 2, S. 565–585). Siehe ebenso den Eintrag im Book of Wonders von 1914: »They [aeroplanes] are the result of evolution–of the combined work and thought of hundreds of men, […]«
(Bodmer, Rudolph J.: The Book of Wonders. Wonders of nature and the wonders produced by man, Richmond 1914, S. 126). Klaus-Dieter Krabiel spricht bei der Möglichkeit der Beherrschung treffend von einem »wechselseitige[n] Angewiesensein von Mensch und Maschine«
(Krabiel, Klaus-Dieter: Brechts Lehrstücke. Entstehung und Entwicklung eines Spieltyps. Stuttgart/Weimar 1993, S. 34).
Marinetti, Filippo Tommaso: »La Nouvelle Religion–Morale de la Vitesse«. In: Giovanni Lista (Hg.): Futurisme. Manifestes, Proclamations, Documents. Lausanne 1973, S. 366–370, hier: S. 369, zit. nach Encke: Augenblicke der Gefahr (wie Anm. 18), S. 59.
Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Frankfurt a. M. 2010, S. 124.
Simondon, Gilbert: Die Existenzweise technischer Objekte. Zürich 2012, S. 81.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Liggieri, K. »Ich starb als Mensch, seitdem ich Flieger wurde«. Zur literarischen Annexion und Akzeptanz technischer Artefakte am Beispiel des Fliegers. Z Literaturwiss Linguistik 45, 79–95 (2015). https://doi.org/10.1007/BF03379903
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03379903