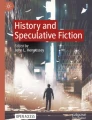Abstract
In the early 19th century the Nazarenes were the first generation of German painters to address medieval topics intensively from their own artistic impulse and a spiritual urge. Finally breaking away from the Vienna Academy, in 1809 the Lukasbund was founded as the nucleus of the Nazarene movement, with >truth< becoming its watchword. Following the writings of Wackenroder, Tieck and Schlegel, Italian paintings from the Middle Ages to the early works of Raphael and the old German masters became their paradigms. A first approach to the Middle Ages was found in the popular historical romances and historical novels that were received by many contemporaries like works of historical science. Soon, however, the romantic and fantastic universe of fiction did not suffice any more, which prompted more detailed studies. In particular, Johann von Müller’s Geschichten der Schweizer Eidgenossenschaft (Tales of the Swiss Confederation), which formed a novel connection of meticulous research with lively literary depiction closely based on the historical sources, satisfied their growing historical awareness. Besides increasingly thorough literary studies, they engaged themselves with individual lines of research, for example concerning historical costume or art monuments. At the same time, however, they shared the contemporary fascination for myths, legends and folklore so characteristic of this early phase of Historicism. Nazarene history painting in its genesis and stylistic characteristics clearly mirrors the change in the conception of history from the Enlightenment to Romanticism and Historicism in Germany. It spotlights the fierce and intense discussion about the range of notions of >truth< in the context of art and history which was to become so fundamental for the later 19th century.
Similar content being viewed by others
Literatur
Schlegel, Friedrich: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Ernst Behler (Hg.), 35 Bde., Paderborn 1958–1975, Bd. 1, S. 165.
Vgl. Fastert, Sabine: Die Entdeckung des Mittelalters. Geschichtsrezeption in der nazarenischen Malerei des 19. Jahrhunderts, München 2000.
Wackenroder, Wilhelm Heinrich: Sämtliche Werke und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Silvio Vietta (Hg.), 2 Bde., Heidelberg 1991, Bd. 1, S. 53.
Vgl. Buntfuß, Markus: Die Erscheinungsform des Christentums. Zur ästhetischen Neugestaltung der Religionstheologie bei Herder, Wackenroder und De Wette, Berlin 2004
Kertz-Welzel, Alexandra: Die Transzendenz der Gefühle. Beziehungen zwischen Musik und Gefühl bei Wackenroder/Tieck und die Musikästhetik der Romantik, St. Ingbert 2001
Pontzen, Alexandra: Künstler ohne Werk. Modelle negativer Produktionsästhetik in der Künstlerliteratur von Wackenroder bis Heiner Müller, Berlin 2000.
Vgl. Hollein, Max/ Steinle, Christa (Hgg.): Religion Macht Kunst. Die Nazarener, Ausstellungskatalog Frankfurt am Main, Schirn-Kunsthalle, Köln 2005
Frank, Mitchell B.: German Romantic Painting Redefined. Nazarene Tradition and the Narratives of Romanticism, Aldershot 2001
Gallwitz, Klaus (Hg.): Die Nazarener in Rom. Ein deutscher Künstlerbund der Romantik, München 1981
Gallwitz, Klaus (Hg.): Die Nazarener, Ausstellungskatalog Frankfurt am Main, Städel, Frankfurt am Main 1977
Andrews, Keith: The Nazarenes. A Brotherhood of German Painters in Rome, Oxford 1964.
Vgl. Büttner, Frank: »Wilhelm Tischbeins >Konradin von Schwaben<«, in: Kunstsplitter. Beiträge zur europäischen Kunstgeschichte, Festschrift für Wolfgang J. Müller, Husum 1984, S. 100–119.
In Deutschland wurden erste Schritte auf dem Feld der Graphik, einer von den Zeitgenossen als >niedere< Kunstgattung angesehenen Sparte, unternommen, wo die normativen Stilvorstellungen der klassizistischen Ästhetik noch am ehesten zu umgehen waren. Vgl. Meier, Hans Jakob: Die Buchillustration des 18. Jahrhunderts in Deutschland und die Auflösung des überlieferten Historienbildes, München 1994
Büttner, Frank: »Bernhard Rodes Geschichtsdarstellungen«, in: Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd.XLII, 1988, S. 33–47
ders.: »Die Darstellung mittelalterlicher Geschichte in der deutschen Kunst des ausgehenden 18. Jahrhunderts«, in: Peter Wapnewski (Hg.): Mittelalter-Rezeption, Stuttgart 1986, S. 407–435.
Brief Johann Friedrich Overbecks an den Vater, Rom 8. Februar 1915, zit. nach Hasse, Paul Ewald: »Aus dem Leben Johann Friedrich Overbecks. Briefe an die Eltern und Geschwister (Teil 2)«, in: Allgemeine Conservative Monatsschrift für das christliche Deutschland, Bd. 45, 1888, S. 39–56, S. 157–177, hier S. 160.
Brief Franz Pforrs an Johann David Passavant, Wien 6. Januar 1809, zit. nach Fastert 2000 (wie Anm. 1), S. 41. Vgl. zur Geschichtsmalerei allgemein Büttner, Frank: »Aufstieg und Fall der Geschichtsmalerei. Ein Überblick über die Entwicklung von Gattungsgeschichte und Gattungstheorie in Deutschland vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert«, in: Ulrich Baumgärtner/ Monika Fenn (Hgg.): Geschichte zwischen Kunst und Politik (Münchner Geschichtsdidaktisches Kolloquium, 4), München 2002, S. 33–58
Haskell, Francis: Die Geschichte und ihre Bilder. Die Kunst und die Deutung der Vergangenheit, München 1995
Hager, Werner: Geschichte in Bildern. Studien zu Historienmalerei des 19. Jahrhunderts, Hildesheim 1989
Wagner, Monika: Allegorie und Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19. Jahrhunderts in Deutschland von der Cornelius-Schule zur Malerei der Wilhelminischen Ära, Tübingen 1989
Brieger, Peter: Die deutsche Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts, Berlin 1930.
Brief Franz Pforrs an Johann David Passavant, Wien 1. Juni 1808, zit. nach Fastert 2000 (wie Anm. 1), S. 247. Vgl. Lehr, Fritz Herbert: Die Blütezeit romantischer Bildkunst: Franz Pforr, der Meister des Lukasbundes; mit einem Anhang bisher unveröffentlichter Manuskripte romantischer Maler und Zeichner Pforr, Overbeck, Cornelius u. a., Marburg an der Lahn 1924.
Cramer, Karl Gottlob: Adolph der Kühne, Raugraf von Dassel. Dramatisiert vom Verfasser des deutschen Alcibiades, 3 Teile, Weißenfels/Leipzig 1792, S. 13 ff.
Vgl. Diu, Isabelle: Mémoire des chevaliers, édition, diffusion et réception des romans de chevalerie du XVIIe au XXe siècle; actes du colloque international organisé par l’École Nationale des Chartes, Paris 2007
Hartje, Ulrich: Trivialliteratur in der Zeit der Spätaufklärung. Untersuchungen zum Romanwerk des deutschen Schriftstellers Christian Heinrich Spiess (1755–1799), Frankfurt a. M. 1995
Reisenleitner, Markus: Die Produktion literarischen Sinnes: Mittelalterrezeption im deutschsprachigen historischen Trivialroman vor 1848, Frankfurt a. M. 1992.
Anonymer Verfasser der Satire »Ekto von Ardelk und Elika von Bollerhausen, von Eppo Attila, Geschichts- und Geschwindschreiber zu Burg Weissenfels«, zit. nach Müller-Fraureuth, Karl: Die Ritter- und Räuberromane, Halle 1894, S. 99.
Schlegel, August Wilhelm: Sämmtliche Werke. Eduard Böcking (Hg.), 12 Bde., Leipzig 1846–1847, Bd. 11, S. 11.
Nicolai, Carl: Versuch einer Theorie des Romans. Kritisch-philosophisch behandelt, Bd. 1, Quedlinburg/Leipzig 1819, S. 167.
Brief Franz Pforrs an Johann David Passavant, Wien 1. Juni 1808, zit. nach Fastert 2000 (wie Anm. 1), S. 67. Vgl. Fastert, Sabine: »>Ein Muster der Kraft und Ergebung, der Frömmigkeit und Tugend<: zur Rezeption Rudolfs von Habsburg in der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts«, in: Götz Pochat (Hg.): Kunst/Geschichte zwischen historischer Reflexion und ästhetischer Distanz, Graz 2000, S. 79–94
Brief Franz Pforrs an Johann David Passavant, Wien 6. Januar 1809, zit. nach Fastert 2000 (wie Anm. 1), S. 70. Vgl. Löcher, Kurt: »Zu Franz Pforrs Einzug Kaiser Rudolfs von Habsburg in Basel. Vom Nutzen Wiener Studienjahre«, in: Bruno Klein (Hg.): Nobilis arte manus: Festschrift zum 70. Geburtstag von Antje Middeldorf Kosegarten, Dresden 2002, S. 428–440
Sonnabend, Martin: »Franz Pforr in Rom«, in: Margret Stuffmann (Hg.): Zeichnen in Rom, 1790–1830, Köln 2001, S. 428–440.
Pforrs Studiumsbericht an Sarasin, Wien 1810, zit. nach Fastert 2000 (wie Anm. 1), S. 55.Vgl. Ziemke, Hans-Joachim: »Franz Pforrs Studiumsbericht«, in: Hildegard Bauereisen (Hg.): Correspondances: Festschrift für Margret Stuffmann zum 24. November 1996, Mainz 1996, S. 135–146.
Pforrs Studiumsbericht an Sarasin, Wien 1810, zit. nach Fastert 2000 (wie Anm. 1), S. 56. Vgl. Polonyi, Eszter: »The Problem with >Retro<: Franz Pforr and Nazarene art«, in: Inferno, Bd. 11, 2006, S. 25–35.
Schiller, Friedrich: Der Graf von Habspurg. Faksimile der Handschrift. Bernhard Zeller (Hg.), Marbach/Neckar 1982, S. 19.
Vgl. Steiner, Reinhard: »Experiment und Epiphanie: Anmerkungen zum tachistoskopischen Experiment in Hans Sedlmayrs Aufsatz Pieter Bruegel: Der Sturz der Blinden«, in: Christian Drude/ Hubertus Kohle (Hgg.): 200 Jahre Kunstgeschichte in München: Positionen, Perspektiven, Polemik, München 2003, S. 199–208.
Vgl. Kohnen, Michael: »Die Nazarener Joseph Wintergerst und Christian Xeller«, in: Carl Ludwig Fuchs (Hg.): Biedermeier in Heidelberg 1812–1853, Heidelberg 1999, S. 104–119
Jensen, Jens Christian: »Das Werk des Malers Josef Wintergerst«, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 21 (1967) S. 21–58.
Vgl. Thommen, Heinrich: Ludwig Vogel im Kreise seiner Malerfreunde in Wien und Rom 1808–1815, Basel 1988; ders.: »Gedanken zur Ikonographie im Werk des Zürcher Malers Ludwig Vogel (1788–1879)«, in: Unsere Kunstdenkmäler 32 (1981) S. 406–421.
Vgl. Thommen, Heinrich: »Ludwig Vogels Kopien und die Entdeckung von Franz Pforrs Costümsammlung im Klebealbum LM 68606 des Schweizerischen Landesmuseums«, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 62 (2005) S. 91–130.
Vgl. Walser-Wilhelm, Doris/ Berlinger Konqui, Marianne (Hgg.): Geschichtsschreibung zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Umkreis Johannes von Müllers und des Groupe de Coppet, Paris 2004
Gottlob, Michael: Geschichtsschreibung zwischen Aufklärung und Historismus. Johannes von Müller und Friedrich Christoph Schlosser, Frankfurt a. M. 1989
Pape, Matthias: Johannes von Müller, seine geistige und politische Umwelt in Wien und Berlin 1793–1806, Bern 1989.
Vgl. Müller, Johannes von: Die Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft, 3 Bde., Leipzig 1806, Bd. 1, S. 529 und 532 f.
Müller, Johannes von: Sämmtliche Werke. Johann Georg Müller (Hg.), 40 Bde., Stuttgart 1831–1835, Bd. 39, S. 310.
Dieser Teil der Residenz wurde 1944 während eines Bombenangriffs zerstört. Vgl. Fastert 2000 (wie Anm. 1); Seeliger, Stephan (Hg.): Julius Schnorr von Carolsfeld. Aus dem Leben Karls des Großen. Kartons für die Wandbilder der Münchner Residenz, Ausstellungskatalog Dresden, Kupferstichkabinett, Köln 1999
Erichsen, Johannes: »>Aus dem Gedächtnis ins Herz<. Zum Verhältnis von Kunst, Geschichte und Politik unter König Ludwig I.«, in: Johannes Erichsen/ Ulrich Puschner (Hgg.): >Vorwärts, vorwärts sollst du schauen …<. Geschichte, Politik und Kunst unter Ludwig I., Aufsätze, München 1986, S. 385–418
Wasem, Eva-Maria: Die Münchner Residenz unter Ludwig I. Bildprogramme und Bildausstattungen in den Neubauten (Miscellanea Bavarica Monacensia 101), München 1981.
Schnorr-Archiv 45.1, Bl. 7, SLUB Dresden; vgl. auch Schnorr von Carolsfeld, Julius: Künstlerische Wege und Ziele, Leipzig 1909, S. 80.
Schnorr-Archiv 45.1, Bl. 17, SLUB Dresden, zit. nach Fastert (wie Anm. 1), S. 217. Zur Bedeutung Karls des Großen in der Kunst des 19. Jahrhunderts vgl. zuletzt Büttner, Frank: »Karl der Große und sein Nachleben in Geschichte, Kunst und Literatur«, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 104/105 (2002/2003) S. 347–403.
Vgl. Hormayr, Joseph: Österreichischer Plutarch oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der berühmtesten Feldherren, Staatsmänner, Gelehrten und Künstler des österreichischen Kaiserstaates, Bd. 1, Wien 1807
Lichnowski, Eduard Maria von: Geschichte des Hauses Habsburg, Bd. 1, Wien 1836.
Vgl. Raumer, Friedrich von: Geschichte der Hohenstaufen, Bd. 2, Leipzig 1823
Funck, Karl Wilhelm Ferdinand: Gemälde aus den Zeiten der Kreuzzüge, Bd. 3, Leipzig 1824
Wilken, Friedrich: Geschichte der Kreuzzüge, Bd. 4, Leipzig 1826.
Vgl. Luden, Heinrich: Geschichte des teutschen Volkes, Bd. 4, Gotha 1828.
Grimm, Jakob: »Gedanken wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten (1808)«, in: ders.: Kleinere Schriften, Bd. 1, Berlin 1864, S. 401 f.
Bei der Darstellung der Eroberung Pavias hält Karl bei einem früheren Entwurf ebenfalls die Lanze in der Hand, im ausgeführten Fresko dann aber ein erhobenes Schwert. Vgl. Grimme, Ernst Günther: »Alexander, Konstantin, Karl? Zu einer Zeichnung Der Einzug Karls des Großen in Pavia von Julius Schnorr von Carolsfeld«, in: Architektur und Kunst im Abendland. Festschrift für Günter Urban, Rom 1992, S. 257–264.
Vgl. Sandkühler, Hans Jörg (Hg.): Weltalter — Schelling im Kontext der Geschichtsphilosophie, Hamburg 1996
Hutter, Axel: Geschichtliche Vernunft. Die Weiterführung der Kantischen Vernunftkritik in der Spätphilosophie Schellings, Frankfurt a. M. 1996.
Vgl. Schmeier, Elke-Barbara: Zur politischen Philosophie im Spätwerk Friedrich Schlegels. Die Aushöhlung des sittlichen Fundaments durch den Liberalismus, Frankfurt a. M. 1997
Behrens, Klaus: Friedrich Schlegels Geschichtsphilosophie (1794–1808). Ein Beitrag zur politischen Romantik, Tübingen 1984.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Fastert, S. Zwischen Ritterroman, Geschichtswissenschaft, Legenden- und Sagenwelt. Z Literaturwiss Linguistik 38, 81–106 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03379796
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03379796