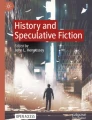Wir interessieren uns besonders für Dinge, die wir verändern können. R. Sennett: Handwerk1 Uns interessiert, was, in einer Welt, in der es offenkundig ist, daß Katastrophen eintreten, die stoffverändernde Arbeit leistet. O. Negt/A. Kluge: Geschichte und Eigensinn2
Abstract
In Morenga (1978) Uwe Timm records the atrocities of the Germans in »South-West Africa«, as Namibia was once called. The novel relates of veterinary Gottschalk’s three-year stay (1904–1907) in that conflict-ravaged land, as he gradually adopts an anti-colonial position in the face of colonizer’s brutality against Nama’s uprising.
This paper describes the elaboration techniques of the Other, how in Morenga the image of the Other is entangled and subsequently shaped in a matrix of data, fictional and archival documents. Therefore, I shall focus on the category of labour, especially as craftsmanship, in thematic and narratological terms; as a result of my analysis I will show that Gottschalk’s veterinary activity, through its potential for transformation and communication, makes possible a non-violent contact with the Other.
Gottschalk’s attempt to decode the Other’s world beyond the patterns of hegemonic thinking is an example of ›enlightenment‹ literature of the late 70s, between documentary and fiction. By repeatedly interrupting of narration, the assemblage techniques, the distance-creating gesture of reflecting and the medialization of the Other Timm avoids any exoticism and aims to deconstruct German colonialism. His narrative procedures, which are partly due to the ethnographic practice, also reflect the crisis of representation which characterizes the ethnographic discourse of those years.
Similar content being viewed by others
Literatur
Sennett, Richard: Handwerk. Übers. von M. Bischoff. Berlin 2008, S. 163 (Original: The Craftsman, 2008).
Negt, Oskar/ Kluge, Alexander: Geschichte und Eigensinn. Frankfurt a. M. 1981, S. 5.
Timm, Uwe: Morenga [1978]. Ungek., vom Autor neu durchges. Ausg. München 2000, S. 245–246 (von nun an: M). Timm verwendet meistens die damals noch geläufige Bezeichnung »Hottentotte/in«, die heute abwertend klingt und von der korrekteren »Nama« ersetzt worden ist, die ich hier verwende; dagegen habe ich die noch in den 1970er Jahren offizielle Landbezeichnung »Südwestafrika« (in den Dokumenten der kolonialen Zeit: »Deutsch-Südwestafrika «) anstatt der heutigen (»Namibia«) beibehalten.
Bekannterweise ist dieser Begriff nicht ganz unproblematisch. Im Deutschen hat man lange eher von »dem Fremden« gesprochen, während sich in der letzten Zeit der Terminus »das Andere« (oder »der/die Andere/n«)–als Übersetzung des geschlechtsneutralen englischen Terminus »the Other«–durchgesetzt hat. Beide Begriffe sind natürlich nur aufgrund der Gegenüberstellung zu »dem Eigenen« zu verstehen, und werden oft synonym verwendet, da sie sich zu einem guten Teil semantisch decken. Über diese terminologische Frage s. Berg, Eberhard/ Fuchs, Martin: »Vorwort«. In: Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. Hg. von Eberhard Berg u. Martin Fuchs. Frankfurt a. M. 1993, S. 7–10 (insbes. S. 9) und
Wierlacher, Alois: »Ausgangslage, Leitbegriffe und Problemfelder«. In: Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. Hg. von Alois Wielacher. München 1993, S. 19–114, insbes. S. 62–70; über den Ausdruck »fremd« s.
Rath, Matthias: »Von der ›(Un)Möglichkeit, sich in die Fremde hineinzuleben‹. Kulturelle Assimilation als Desintegration am Beispiel von Ilija Trojanows Roman Der Weltensammler«. In: arcadia 45, 2 (2010), S. 446–466, insbes. S. 449–453. Über die Notwendigkeit, die gesamte Terminologie und die Logik der »binäre[n] Codes, die eine erhebliche Reduktion von Komplexität erzeugen«, kritisch zu überprüfen, s.
Lubrich, Oliver: Das Schwinden der Differenz. Postkoloniale Poetiken. Bielefeld 2004, insbes. das 6. Kap., zit. S. 297. Schon Said, für den die Bedeutung dieser Termini vom jeweiligen kulturnationalen Kontext stark abhängt, wies auf die Gefahr hin: »The fetishization and relentless celebration of ›difference‹ and ›otherness‹ can […] be seen as an ominous trend« (
Said, Edward W.: »Representing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors«. In: Critical Inquiry 15, 2 (1989), S. 205–225, zit. S. 213).
Timm akzeptiert den Vorwurf, auch er habe letztendlich den Kolonisierten nicht zur Sprache kommen lassen, und beteuert, er hätte das als Anmaßung empfunden (vgl. Hamann, Christof/ Timm, Uwe: »›Einfühlungsästhetik wäre ein kolonialer Akt‹. Ein Gespräch«. In: Sprache im technischen Zeitalter 168 (2003), S. 450–462, insbes. S. 452–454; das monographische Heft trägt den Titel: Hic sunt leones. Der deutsche Kolonialismus in Südwestafrika in der Literatur). Denselben Vorwurf formuliert am Ende ihres Beitrags
Wilke, Sabine: »›Hätte er bleiben wollen, er hätte anders denken und fühlen lernen müssen‹: Afrika geschildert aus Sicht der Weißen in Uwe Timms Morenga«. In: Monatshefte 93, 3 (2001), S. 335–354.
Für eine Lektüre Morengas im Kontext des politischen Engagements Timms in den 1970er Jahren s. Hermand, Jost: »Afrika den Afrikanern! Timms Morenga«. In: Die Archäologie der Wünsche. Studien zum Werk von Uwe Timm. Hg. von Manfred Durzak u. Hartmut Steinecke in Zusammenarb. m. Keith Bullivant. Köln 1995, S. 47–63.
Timm, Uwe: Von Anfang und Ende. Über die Lesbarkeit der Welt. Frankfurter Poetikvorlesung. Köln 2009, S. 90–91 (von nun an: AE).
Folgt man Huyssen, Andreas: »Transnationale Verwertungen von Holocaust und Kolonialismus«. In: Elisabeth Wagner/ Burkhardt Wolf (Hg.): VerWertungen von Vergangenheit. Mosse-Lectures 2008 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 2009, S. 30–50, dann ist Timms Intuition im Kontext einer spezifisch deutschen kritischen Position zu lesen, so wie »die Verbindung von deutschem Kolonialismus (Genozid an den Hereros) und Holocaust […] ein nationaler und eben nicht transnationaler Sonderfall« (S. 43) ist. Nach Huyssen gerät die »konstitutive Verflechtung von Holocaustdiskurs, Kolonialgeschichte und Moderne« in der postkolonialen Theorie »nur selten ins Blickfeld« (S. 44), weshalb dann »Kolonial- und Holocausterinnerung« (ebd.) im Gedächtnisdiskurs meistens getrennt blieben (und dazu oft im Konflikt miteinander). Lützeler hat allerdings darauf hingewiesen, dass es die 68er Bewegung war, die zum ersten Mal »[d]ie Zusammenhänge zwischen dem überseeischen Kolonialismus der Bismarck-Ära und dem kolonialistischen Projekt Hitlers« ans Licht brachte (
Lützeler, Paul Michael: Postmoderne und postkoloniale deutschsprachige Literatur. Diskurs–Analyse–Kritik. Bielefeld 2005, S. 98). Dazu s. noch
Göttsche, Dirk: »Colonialism and National Socialism: Intersecting Memory Discourses in Post-War and Contemporary German Literature«. In: Gegenwartsliteratur 9 (2010), S. 217–242.
Ein eigenes Kapitel wäre der Darstellung der Räume und der Narrativierung der geographischen Karten in Morenga zu widmen, sowie dem Versuch Timms, sie den Mustern und Koordinaten des Kolonialdiskurses zu entziehen. Über die Konstruktion des Raums in einem kolonialen System s. Honold, Alexander: »Flüsse, Berge, Eisenbahnen: Szenarien geographischer Bemächtigung«. In: Das Fremde. Reiseerfahrungen, Schreibformen und kulturelles Wissen. Hg. von Alexander Honold, Klaus R. Scherpe. Bern u. a. 1999, S. 149–174. Die Konzeption der Wüste als leerer Raum, den die deutschen Kolonisatoren mit ihrer Kultur und Arbeit ordnen und ausfüllen wollten, war entscheidend für die deutsche Kolonialpolitik; jene Konzeption fungierte später als Paradigma für die nationalsozialistischen Expansionsprojekte in Osteuropa (dazu s.
Werber, Niels: »Archive und Geschichten des ›Deutschen Ostens‹. Zur narrativen Organisation von Archiven durch die Literatur«. In: Thomas Weitin/ Burkhardt Wolf (Hg.): Gewalt der Archive. Studien zur Kulturgeschichte der Wissensspeicherung. Konstanz 2012, S. 89–111). Über das »Verhältnis der Literatur zur Kartographie«, das nach Stockhammer zwischen »der Teilhabe an einem Dispositiv der Verortung und dem Wunsch, sich der Verortung zu entziehen«, oszilliert, s.
Stockhammer, Robert: »Verortung. Die Macht der Karten und die Literatur, im 20. Jahrhundert«. In: TopoGraphien der Moderne. Medien zur Repräsentation und Konstruktion von Räumen. Hg. von R. S. München 2005, S. 319–340, zit. S. 338.
Die Textstelle geht so weiter: »Stunde um Stunde waren sie durch eine menschenleere Landschaft geritten. Und doch waren irgendwo Augen, die ihn sahen, seine Bewegungen verfolgten« (M, 109; s. auch die nächste Anm.). Von einem ähnlichen Gefühl berichtet Timm in einem Text über seine Reise nach Namibia. Timm beschreibt seinen Spaziergang abends in einer menschenleeren Straße und seine Angstreaktion auf die Begegnung mit drei Schwarzen, die ihm auf derselben Straßenseite entgegenkommen: Er, der westliche Beobachter, wird zum Beobachtungsobjekt, denn er trägt mit seiner weißen Haut »ein Kainszeichen der Gewalt und zugleich deren Gegenteil: Angst. Diese Angst, die Angst der Herren, sitzt in diesem Land den Weißen im Genick.–Heute wie damals, 1904, als der Aufstand ausbrach« (Timm, Uwe: »Wo die Weißen schwarz sehen. Eindrücke einer Recherchereise nach Namibia im Jahre 1976« [1976]. In: Uwe Timm Lesebuch. Die Stimme beim Schreiben. Hg. von Martin Hielscher. München 2005, S. 53–59, zit. S. 59).
Dazu s. Albrecht, Andrea: »Thick descriptions. Zur literarischen Reflexion historiographischen Erinnerns ›am Beispiel Uwe Timms‹«. In: Erinnern, Vergessen, Erzählen. Beiträge zum Werk Uwe Timms. Hg. von Friedhelm Marx unter Mitarb. von Stephanie Catani u. Julia Schöll. Göttingen 2007, S. 69–89.
Timm, Uwe: Erzählen und kein Ende. Versuche zu einer Ästhetik des Alltags. Köln 1993, S. 139. Nicht zufällig wählt Timm als Titel einer Sammlung von Aufzeichnungen gerade die Formulierung, mit der Geertz die Perspektive der thick description bezeichnet: »Der Blick über die Schulter oder Notizen zu einer Ästhetik des Alltags« [1989], nun in: Uwe Timm Lesebuch (s. Anm. 19), S. 168–192; eine der Notizen trägt als Überschrift: »Das Auge des Ethnologen «, so wie übrigens auch eine der ebenfalls 1989 erschienenen Römischen Aufzeichnungen, die insgesamt einen dezidiert ethnographischen Ansatz aufweisen.
Ebd., S. 111. Hamann, der selbst einen Afrika-Roman (Usambara, 2007) geschrieben und sich mit (post)kolonialen Themen beschäftigt hat, problematisiert das Verhältnis von Authentizität und Erfindung in literarischen Texten, indem er vom »Gemachtsein von Authentizität« spricht, die »nicht da ist, sondern mit Hilfe von literarischen Verfahren geschaffen wird« (Hamann, Christof: »Ruinieren, Verketten, Verformen. Zum Umgang mit Materialien beim Schreiben«. In: Ins Fremde schreiben. Gegenwartsliteratur auf den Spuren historischer und fantastischer Entdeckungsreisen. Hg. von Christof Hamann u. Alexander Honold. Göttingen 2009, S. 313–322, zit. S. 321).
Berg/Fuchs: »Vorwort« (wie Anm. 4), S. 7. Der von Berg und Fuchs herausgegebene Band bietet einen ausgezeichneten Überblick über die ganze Problematik, da er Beiträge einiger der wichtigsten Theoretiker auf dem ethnographischen und kulturanthropologischen Gebiet enthält, darunter Clifford, Tyler, Rabinow, Bourdieu. Schon Baumbach hat sich auf diesen Band bezogen, um Morenga vor dem Hintergrund des ethnographischen Diskurses zu interpretieren: Baumbach, Kora: »Literarisches going native. Zu Uwe Timms Roman Morenga«. In: Frank Finlay/ Ingo Cornils (Hg.): »(Un-)erfüllte Wirklichkeit«. Neue Studien zu Uwe Timms Werk. Würzburg 2006, S. 92–112.
Vgl. Fuchs, Martin/Berg, Eberhard: »Phänomenologie der Differenz. Reflexionsstufen ethnographischer Repräsentation«. In: Berg/Fuchs: Kultur, soziale Praxis, Text (wie Anm. 4, S. 11–108, insbes. S. 40–41. Sehr interessant dazu Scherpe, Klaus R.: »Grenzgänge zwischen den Disziplinen. Ethnographie und Literaturwissenschaft«. In: Petra Boden/ Holger Dainat (Hg.): Atta Troll tanzt noch. Selbstbesichtigungen der literaturwissenschaftlichen Germanistik im 20. Jahrhundert. Berlin 1997, S. 297–315. Vgl. auch
Bachmann-Medick, Doris: »Einleitung«. In: D. B.-M. (Hg.): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. Frankfurt a. M. 1996, S. 7–64. In der Einleitung zu dem von ihnen herausgegebenen Band (Ins Fremde schreiben (wie Anm. 43), S. 9–20) behaupten Hamann und Honold, dass die Literatur »eng verschwistert mit dem ethnographischen Blick und der ethnologischen Neugier« sei, da sie (genauer: »Die soziale Bedeutung des Mediums Literatur«) sich »zu einem Gutteil aus dem Interesse am Fremden« speise (»Ins Fremde schreiben. Zur Literarisierung von Entdeckungsreisen in deutschsprachigen Erzähltexten der Gegenwart«. In: Ins Fremde schreiben, S. 10).
Scherpe, Klaus R.: »Der Schrecken der Anderen: Über koloniale und postkoloniale Repräsentation«. In: Literatur für Leser 33, 4 (2010), S. 233–253, zit. S. 253. In Morenga finden wir das Gegenteil von jener »asyndetische[n] Reihung der einzeln aufgerufenen Preziosa des Fremden und deren Verkettung zu Bildeindrücken« (ebd., S. 238), mit der man nach Scherpe in den Kolonialromanen den Schrecken in der Fremde zu überwinden sucht. Sehr interessant dazu auch Scherpe, Klaus R.: »Die Ordnung der Dinge als Exzeß. Überlegungen zu einer Poetik der Beschreibung in ethnographischen Texten«. In: Honold/Scherpe: Das Fremde (wie Anm. 17), S. 13–44.
Bullivant, Keith: »Reisen, Entdeckungen, Utopien: zum Werk Uwe Timms«. In: Deutsche Bücher 25, 4 (1995), S. 255–262, sieht unter anderem »in der Verbindung von offenem Ende und polyphonem Erzählstil […] die Nähe [Morengas] zur postmodernen Ethnologie« (S. 256).
Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Übers. von U. Köppen. Frankfurt a. M. 1981, S. 188 (kursiv im Original: L’archéologie du savoir, 1969).
Derrida, Jacques: Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression. Übers. von H.-D. Gondek/H. Naumann. Berlin 1997, S. 53 (Original: Mal d’archive. Une impression freudienne, 1995).
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Corrado, S. Die Erarbeitung des Anderen. Z Literaturwiss Linguistik 43, 95–122 (2013). https://doi.org/10.1007/BF03379699
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03379699