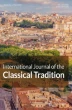Abstract
In the reception of Graeco-Roman antiquity during the 18th and early 19th centuries, the Homeric epics and their translations played an important role. Goethe, himself a lifelong admirer of Homer, studied intensively the translation by Johann Heinrich Voss, which in the realm of the German tongue was quickly to gain the stature of a ‘classic’ in its own right. Between Goethe and Voss there existed many fundamental agreements but also obvious differences. Despite certain reservations on matters of detail, Goethe increasingly valued Voss's translations of theOdyssey (1781, revised 1793) and of theIliad (1793), recognized them as models of translation in general, and showed their influence in his own poems and his translations. Especially in the rendition of Homeric similes in hisAuszug aus der Ilias [Excerpts from the Iliad] of 1820/21 did he base himself on Voss's translations.
Similar content being viewed by others
References
Zum Folgenden vgl. Georg Finsler,Homer in der Neuzeit von dante bis Goethe. Italien, Frankreich, England, Deutschland, Leipzig-Berlin 1912 [Nachdr. Hildesheim-New York 1973]; W[illiam] B[edell] Stanford,The Ulysses Theme. A Study in the Adaptability of a Traditional Hero, Oxford 1954 [3. Aufl., Dallas 1992]; Noémi Hepp,Homère en France au XVIIe Siècle, Paris 1968; Thomas Bleicher:Homer in der deutschen Literatur (1560–1740). Zur Rezeption der Antike und zur Poetologie der Neuzeit, Germanistische Abhandlungen 39, Stuttgart 1972; Häntzschel, S. 1–38; Gilbert Highet,The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford 1949 (8. Aufl., New York-London 1978); August Buck,Humanismus. Seine europäische Entwicklung in Dokumenten und Darstellungen, Orbis academicus, Freiburg-München 1987, S. 305–328 und 343–358;Homer, ed. by Katherine Callen King, Classical Heritage 5=Garland Reference Library of the Humanities 1531, New York-London 1994;Homère en France qprès la Querelle (1715–1900). Actes du colloque de Grenoble (23–25 octobre 1995) Université Stendhal-Grenoble 3 éd. par Françoise Létoublon et Catherine Volpilhac Auger, avec la collaboration de Daniel Sangsue, Champion-Varia 32, Paris 1999;Wiedergeburt griechischer Götter und Helden. Homer in der Kunst der Goethezeit. Eine Ausstellung der Winckelmann-Gesellschaft im Wincklemann-Museum Stendal, 6. November 1999 bis 9. Junuar 2000, hrsg. von Max Kunze, Konzeption und wissenschaftliche Leitung: Axel Rügler und Max Kunze, Mainz 1999 (rezensiert von Theodore Ziolkowski in dieser Zeitschrift [IJCT] 8 [2001/02], S. 333–335).—Zur Antikerezeption im 18. und frühen 19. Jahrhundert vgl. auch folgende Publikationen des Verfassers:Lessing und die römische Literatur, Weimar 1976;Literarische Antikerezeption. Aufsätze und Vorträge, Jenaer Studien 2, Jena 1996;Antikerezeption in der deutschen Literatur vom Renaissance-Humanismus bis zur Gegenwart. Eine Einführung, Stuttgart—Weimar 2000; „Der Beste der Griechen”—„Achill das Vieh”. Aufsätze und Vorträge zur literarischen Antikerezeption II, Jenaer Studien 5, Jena 2002. [Zu den drei zuletzt genannten Werken s. den Besprechungsaufsatz von T. Ziolkowski, “Ex oriente lux: An East German View of the Classical Tradition”, unten in diesem Heft (IJCT 8.4 [Spring 2002]) S. 603–609.—W.H.]
WA I, Bd. 28, S. 144 f.—Zur Homer-Rezeption nach 1770 vgl. Gerhard Lohse, “Die Homerrezeption im ‘Sturm und Drang’ und deutscher Nationalismus im 18. Jahrhundert”, in:International Journal of the Classical Tradition 4 (1997/98), S. 195–231.
Friedrich Schiller, „Der Spaziergang”, in:Schillers Werke. Nationalausgabe, Weimar 1943 ff., Bd. 2/1 (1983), S. 314.
Friedrich Hölderlin, „Mnemosyne”, in: Hölderlin,Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe, hrsg. von Friedrich Beißner, Stuttgart 1946–1985, Bd. 2/1 (1951), S. 198.
Vgl. Anm. 2.—Die Ausstellung ist im Jahre 2000 in verkürzter Form auch in Otterndorf gezeigt worden.
Vgl. Joachim Latacz/Gerhard Kurz, “Homerische Frage”, in:Der Neue Pauly 14, Stuttgart-Weimar 2000, Sp. 501–516.
Zur schwierigen Wiederentdeckung Homers in der Renaissance vgl. Robin Sowerby, „Early Humanist Failure with Homer”, in:International Journal of the Classical Tradition 4 (1997/98), S. 37–63 und 165–194.—Das Zitat stammt aus Paul Gerhardts „Weltskribenten und Poeten” (Gerhardt,Wach auf, mein Herz und singe. Gesamtausgabe seiner Lieder und Gedichte, hrsg. von Eberhard von Cranach-Sichart, Wuppertal-Kassel21991, S. 110).—Gottsched hat zwar mehrfach Homer gepriesen—aber recht pauschal, ohne allzu genaue Kenntnis und mit Polemik gegen dessen „Fehler”, „Schnitzer” und „Mängel” (vgl. Thomas Bleicher [wie Anm. 2], S. 204–206.) Unter den Dichtern des Altertums nennt er als „Poeten von gutem Geschmacke” und „Muster, die man jungen Leuten vorlegen muß” nur Terenz, Vergil, Horaz und Ovid—und zu Vergil bemerkt er, daß dieser „die Geschicklichkeit besessen [hat], dem Homer so vernünftig nachzuahmen, daß er ihn in vielen Stücken übertroffen hat. Und dieses war kein Wunder, da er bereits zu viel feinern und gesittetern Zeiten lebte, da man weit bessere Begriffe von Göttern, Tugenden und Lastern, und von allem, was groß, schön und schätzbar war, hatte.” (Johann Christoph Gottsched,Versuch einer Critischen Dichtkunst, durchgehends mit den Exempeln unserer besten Dichter erläutert, Leipzig41751 [Repograph. Nachdr. Darmstadt 1962], S. 90, 131 und 474.)
Vgl. Häntzsch, S. 26.
Des Homerus Werke. Aus dem Griechischen neu übersetzet und mit einigen Anmerkungen erläutert von Christian Tobias Damm, Lemgo 1769–1771;Homers Ilias, verdeutscht durch Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Flensburg-Leipzig 1778;Homers Werke. Aus dem Griechischen übersetzt von dem Dichter der Noachide, Zürich 1778; Gottfried August Bürger,Sämtliche Werke. Neue Original-Ausgabe, Göttingen 1844, Bd. 2:Homers Iliade, von neuem etrisch übersetzt [von Ernst Wratislaw Wilhelm von Wobeser], Leipzig 1781–1787.—Zur Einschätzung der deutschen Homer-Übersetzungen vor Voß vgl. Häntzschel, S. 25–38. Welche Bedeutung die Übersetzungen antiker Autoren im 18. Jahrhundert hatten und welch entscheidende Rolle Voß bei deren Bewertung zukommt, wird jetzt auch durch folgende Publikation deutlich: Stefan Elit,Die beste aller möglichen Sprachen der Poesie. Klopstocks wettstreitende Übersetzungen lateinischer und griechischer Literatur, Die Antike und ihr Weiterleben 3, St. Augustin 2002.
Vgl. die Zeittafal in:AW, S. 543–551.—Grundlegend für Vossens Biographie immer noch: Wilhelm Herbst,Johann Henrich Voß, 3 Bde., Leipzig 1872–1876 [Repr. Bern 1970]. Vgl. weiterhin: Klaus Langenfeld,Johann Heinrich Voß. Mensch.—Dichter—Übersetzer, Eutiner Bibliothekshefte 3, Eutin 1990.
Untersuchung über Homers Leben und Schriften. Aus dem Englischen des Blackwells, Leipzig 1776 [Repr. Eschborn 1995].
„Odüsseus Erzählung von den Küklopen. Aus dem neunten Gesang der Odyssee Homers”, in:Deutsches Museum (1777) 1, S. 462–478; „Homers Odüssee, vierzehnter Gesang, übersetzt”, in:Teutscher Merkur (1779) 1, S. 97–116; “Ueber Ortügia. Aus dem 15. Ges[ang] der Odüssee”, in:Deutsches Museum (1780) 1, S. 302–312.
Homers Odüßee übersezt von Johann Heinrich Voß, Hamburg 1781.
Homers Werke. Von Johann Heinrich Voß, Altona 1793; 2., verb. Aufl., Königsberg 1802; 3., verb. Aufl., Tübingen 1806; 4., stark verb. Aufl., Stuttgart—Tübingen 1814; 5., stark verb. Aufl., Stuttgart-Tübingen 1821.
Vgl. Ernst Theodor Voß, „Nachwort”, in: Johann Heinrich Voß,Idyllen. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1801, Deutsche Neudrucke. Reihe Goethezeit, Heidelberg 1968, S. (29)–(79); Helmut J. Schneider,Bürgerliche Idylle. Studien zu einer literarischen Gattung des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Johann Heinrich Voß, Diss. Bonn 1975; Gerhard Kaiser, „Idyllik und Sozialkritik bei Johann Heinrich Voß”, in: Kaiser,Wandrer und Idylle. Goethe und die Phänomenologie der Natur in der deutschen Dichtung von Geßner bis Gottfried Keller, Göttingen 1977, S. 107–126; Häntzschel, S. 250–253; Friedrich Sengle, „Die klassische Kultur von Weimar”, in: Sengle,Neues zu Goethe. Essays und Vorträge, Stuttgart 1989, S. 39 f.; Siegfried Streller, „Zeitkritik und bürgerliches Selbstbewußtsein in Voß′ Idyllendichtung”, in:Beiträge zu Werk und Wirken von Johann Heinrich Voß (1751–1826), zsgest. von Volker Riedel, Federlese, Neubrandenburg 1989, S. 13–19; Maria Erxleben, „Voß′ Idyllendichtung und ihre Beziehung zu Theokrit und Homer”, Edb., S. 20–28; Ernst Theodor Voß, „Idylle und Aufklärung. Über die Rolle einer verkannten Gattung im Werk von Johann Heinrich Voß”, in:Freiheit durch Aufklärung. Johann Heinrich Voß (1751–1826), hrsg. von Wolfgang Beutin und Klaus Lüders, Bremer Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte 12, Frankfurt a. M. [u. a.] 1995, S. 35–54.
Vgl. Volker Reidel, „Voß als Epigrammatiker”, in:Beiträge zu Werk und Wirken von Johann Heinrich Voß (wie Anm. 16), S. 29–39 (auch in:Impulse 13 [1990], S. 201–213; Riedel,Literarische Antikerezeption [wie Anm. 2], S. 165–172).
Vgl. Lesley Drewing,Die Shakespeare-Übersetzung von Johann Heinrich Voß und seinen Söhnen, Eutiner Forschungen 4=Eutiner Bibliothekshefte 5/6, Eutin 1999.
Vgl. Hartmut Fröschle,Der Spätaufklärer Johann Heinrich Voß als Kritiker der deutschen Romantik, Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 146, Stuttgart 1985; Günter Häntzschel, „Johann Heinrich Voß in Heidelberg. Kontroversen und Mißverständnisse”, in:Heidelberg im säkularen Umbruch. Traditionsbewußtsein und Kulturpolitik um 1800, hrsg. von Friedrich Strack, Deutscher Idealismus 12, Stuttgart 1987, S. 301–323.
Vgl. Klaus Manger, „Nachwort”, in: Johann Heinrich Voß,Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier? Mit Index nominum und Nachwort hrsg. von Klaus Manger, Heidelberg 1984, S. 10–16;Freiheit durch Aufklärung (wie Anm. 16).
Heinrich Heine, „Die romantische Schule”, in: Heine,Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, hrsg. von Manfred Windfuhr, Hamburg 1973–1997, Bd. 8/1 (1979), S. 144.
Friedrich Sengle, „Die klassische Kultur von Weimar, sozialgeschichtlich gesehen”, in: Sengle (wie Anm. 16), S. 39.
Publii Vergilii Maronis Georgicon libri quatuor. Des Publius Vergilius Maronis Landleben, vier Gesänge. Übers. und erklärt von Johann Heinrich Voß, Eutin-Hamburg 1789; Johann Heinrich Voß,Zeitmessung der deutschen Sprache. Beilage zu den Oden und Elegieen, Königsberg 1802.— Vgl. Alfred Kelletat,Voß und die Nachbildung antiker Metren in der deutschen Dichtung. Ein Beitrag zur deutschen Versgeschichte seit Klopstock, Diss. Tübingen 1949 [Masch.]; Häntzschel, S. 53–63;AW, S. 210–236 und 376–379.
Auf der Ausgabe derOdyssee von 1781 und derjenigen derIlias von 1793 basieren z. B.: Homer,Ilias/Odyssee. In der Übertr. von Johann Heinrich Voß. Mit einem Nachw. von Wolf Hartmut Friedrich, München 1963; Homer,Ilias/Odyssee. Übers. von Johann Heinrich Voß. [Mit einem Nachw. von Gerhard Scheibner und einem alphabetischen Verzeichnis von Namen und Begriffen], Bibliothek der Weltliteratur, Weimar 1963.
Robert WoodsEssay on the Original Genius of Homer war 1769 in London erschienen und bereits am 15. März 1770 von Christian Gottlob Heyne in denGöttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen rezensiert worden. 1773 wurde in der Andreäischen Buchhandlung in Frankfurt am Main die deutsche Übersetzung von Christian Friedrich Michaelis veröffentlicht:Robert Woods Versuch über das Originalgenie des Homers. Aus dem Englischen. Diese übersetzung ist am 23. April 1773 in denFrankfurter Gelehrten Anzeigen in einer vermutlich nicht von Goethe stammenden Rezension besprochen worden (WA I, Bd. 37, S. 204–206; vgl. Häntzschel, S. 10 f.). Eine erweiterte englische Ausgabe erschien 1775:Essay on the Original Genius and Writings of Homer. With a Comparative View of the Ancient and Present State of the Troade. Schon 1778 kam die deutsche Übersetzung von Michaelis heraus:Zusätze und Veränderungen, wodurch sich die neue Ausgabe von Robert Woods Versuch über das Originalgenie des Homers von der alten auszeichnet, nebst Vergleichung des alten und gegenwärtigen Zustands der Landschaft von Troja. Aus dem Englischen DieZusätze wurden am 29. August 1778 in denGöttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen in einer anonymen (wahrscheinlich von Heyne stammenden) Rezension vorgestellt.
Wood,Zusätze, S. 4 f.—Das auf S. 5 notierte Zitat aus dem ersten Kapitel des zweiten Buches (354 a 27–32) bezieht sich auf die (von dem Philosophen nicht geteilte) Meinung älterer Meteorologen, daß der Norden der Erdoberfläche hochgelegen sei. (Vgl. Aristoteles,Meteorologie/Über die Welt, übers. von Hans Strohm, Berlin 1970=Aristoteles,Werke in deutscher Übersetzung, hrsg. von Ernst Grumach, fortgef. von Hellmut Flashar, Bd. 12, S. 42 und 171.)
„Ueber Ortügia” (wie Anm. 13).—Übersetzung der Verse 380–484; die Anm. zu Ortygia und zu καϕύπερϕεν (V. 403 f.) auf S. 303–308 und 308 f.
Voß 1781 (so auch im Vorabdruck). 1793 änderte er in: „Eines der meereiland' heißt Syria, […]/ Über Ortygia hin”.—Bodmer (Bd. 2, S. 198) hatte übersetzt: „Ueber Ortygia ligt ein eiland”. Neuere Übersetzer bevorzugen ähnliche Wendungen: Scheibner, „jenseits von Ortygia”; Schadewaldt „über Ortygia hinaus”; Ebener, „hinter Ortygia” Ein grundlegendes Homer-Wörterbuch des 19. Jahrhunderts allerdings erklärte καϕύπερфεν noch mit „nördlich davon” (Vollständiges Wörterbuch über die Gedichte des Homeros und der Homeriden. Zum Schulund Privat-Gebrauch nach dem früheren Seiler'schen Homer-Wörterbuch neu bearb. von Prof. Dr. C. Capelle, Leipzig91889, S. 302).—Es handelt sich um zwei bei Homer geographisch nicht lokalisierte mythische Inseln; Ortygia, das als Geburtsort der Artemis galt, wurde später meist mit der Insel Delos oder mit anderen Kultstätten dieser Göttin identifiziert. (Vgl. Alfred Heubeck/Arie Hoekstra,A Commentary on Homer's Odyssey, Vol. II: Books IX–XVI, Oxford 1989, S. 257; Annemarie Anbühl, „Ortygia”, in:Der Neue Pauly 9, Stuttgart— Weimar 2000, Sp. 79 f.) Voß will erweisen, daß es eine Insel bei Syrakus sei.
Wood,Zusätze, S. 94 f.—Vgl.Il. 7, 86 und 7,88.
Wood,Zusätze, S. 96.—Vgl. Herod, 7,35.
“An Hrn. Prof. Lichtenberg. Ueber den Ocean der Alten”, in:Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur 1 (1780), S. 305.—Vgl.Od. 1,22–24.
Wood,Zusätze, S. 10.—Vgl.Il. 1,436 und 14,77;Od. 9,137 und 15,498 sowie Bodmer, Bd. 1, S. 24 u. ö.—Unter εύναί versteht man Senksteine, die man in ältester Zeit statt der Anker gebrauchte; Schadewaldt und Scheibner übersetzen mit „Ankersteine”, Ebener wählt teils “Senksteine”, teils “Anker”. Voß selbst hat (wie schon Bodmer) εύνή sowohl 1781 wie 1793 stets mit „Anker” übersetzt.
Wood,Zusätze, S. 15.—Vgl. Hes.Theog. 986–911.—Der mythische Strom Eridanos, in den Phaethon stürzte, während seine Schwestern in Schwarzpappeln verwandelt wurden, ist zumeist mit dem Po identifiziert worden. (Vgl. René Bloch, „Eridanos”, in:Der Neue Pauly 4, Stuttgart—Weimar 1998, Sp. 67.
Oscar Fambach,Der Aufstieg zur Klassik in der Kritik der Zeit. Die wesentlichen und die umstrittenen Rezensionen aus der periodischen Literatur von 1750 bis 1795, begleitet von den Stimmen der Umwelt. In Einzeldarstellungen, Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik (1750–1850). Ein Lese- und Studienwerk 3, Berlin 1959, S. 215–309 (Zitate: S. 215, 230 und 261).— Vgl. auch:AW, S. 311–322, 370 f. und 510–513.—Zur geschichtlichen Entwicklung und zur Aussprache des langen offenen e-Lautes im Altgriechischen vgl. Eduard Schwyzer,Griechische Grammatik, Handbuch der Altertumswissenschaft 2, 1, München 1939, Bd. 1, S. 145.
Vgl. Sotera Fornaro, „Friedrich Creuzer und die Diskussion über Philologie und Mythologie zu Beginn des 19. Jhs.”, in:Pontes I. Akten der ersten Innsbrucker Tagung zur Rezeption der klassischen Antike, hrsg. von Martin Korenjak und Karlheinz Töchterle, Comparanda 2, Innsbruck [u. a.] 2001, S. 28–42, bes. S. 38 f.
Zur Beziehung zwischen Goethe und Voß vgl. (neben den Darstellungen bei Herbst [wie Anm. 11] und Häntzschel): Ernst Metelmann, „Johann Heinrich Voß und Goethe”, in:Zeitschrift für deutsche Philologie 62 (1937), S. 145–163; Walter Müller-Seidel, „Goethes Verhältnis zu Johann Heinrich Voß (1805–1815)”, in:Goethe und Heidelberg, hrsg. von der Direktion des Kurpfälzischen Museums, Heidelberg 1949, S. 240–263; Thomas Pester, „Goethe und Jena. Eine Chronik seines Schaffens in der Universitätsstadt”, in:Evolution des Geistes: Jena um 1800. Natur und Kunst, Philosophie und Wissenschaft im Spannungsfeld der Geschichte, hrsg. von Friedrich Strack, Deutscher Idealismus 17, Stuttgart 1994, S. 674–676; Klaus Manger, „Johann Heinrich und Ernestine Voß in Jena (1802–1805)”, in:Johann Heinrich Voß (1751–1826). Beiträge zum Eutiner Symposium im Oktober 1994, hrsg. von Frank Baudach und Günter Häntzschel, Eutiner Forschungen 5, Eutin 1997, S. 85–95; Christof Wingertszahn, „Voß, Johann Heinrich (1751–1826)”, in:Goethe-Handbuch, hrsg. von Bernd Witte, Theo Buck, Hans-Dietrich Dahnke, Regine Otto und Peter Schmidt, Stuttgart—Weimar 1996–1998, Bd. 4/2 (1998), S. 1113–1115; Volker Riedel, „Goethe und Voß. Zum Antikeverhältnis zweier deutscher Schriftsteller um 1800”, in:Johann Heinrich Voß. Kulturräume in Dichtung und Wirkung, hrsg. von Andrea Rudolph, Dettelbach 1999, S. 19–46 (auch in: Riedel, „Der Beste der Griechen” [wie Anm. 2], S. 107–122; mit weiteren Belegen und Literaturangaben); Pablo Kahl, „Goethe, der Göttinger Hain und der Göttinger Musenalmanach”, in: „Der gute Kopf leuchtet überall hervor”.Goethe, Göttingen und die Wissenschaft, hrsg. von Elmar Mittler, Elke Purpus und Georg Schwedt, Göttingen 1999, S. 188–201.
Wilhelm Herbst (wie Anm. 11), Wilhelm Herbst,Johann Henrich Voß, 3 Bde., Leipzig 1872–1876 [Repr. Bern 1970]. Bd. 2/1, S. 269.
Goethe, „Tag-und Jahres-hefte 1794”, in:WA I, Bd. 35, S. 35.
Johann Heinrich Voß an Ernestine Voß, 13. Juni 1794, in:Briefe, Bd. 2, S. 392.—Zur Ablehnung desReineke Fuchs vgl. auch Ernestine Voß, „Über Voßens Verhältnis zu Schiller und Goethe”, Ebd., Bd. 3/2, S. 56.
Voß an Gleim, 24. September 1797, in:Briefe, Bd. 2, S. 339.
Voß „an Goethe”, in:AW, S. 159.
Vgl. „Ein Dichter hatte uns alle geweckt”. Goethe und die literarische Romantik. Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum, Ausstellung im Frankfurter Geothe-Museum 19. Juni–31. Juli 1999, hrsg. von Christoph Perels, Frankfurt a. M. 1999.
WA IV, Bd. 10, S. 165.
Goethe, „Tag-und Jahres-Hefte 1802”, in:WA I, Bd. 35, S. 137.
Ernestine Voß an Heinrich Christian Boie, 13. November 1802, in:Gespräche, Bd. 1, S. 870.
Ernestine Voß, „Über Voßens Verhältnis zu Schiller und Goethe”, in:Briefe, Bd. 3/2, S. 54.—Vgl. auch aus dem Brief an Boie (wie Anm. 45): „[…] herzlich kann man wohl nicht mit ihm werden.”
WA I, Bd. 40, S. 263–268.
Goethe, „Campagne in Frankreich”, in:WA I, Bd. 33, S. 243; Brief an Voß, 1. Juli 1795, in:WA IV, Bd. 10, S. 274; Brief an Schiller, 28. Februar 1798, in:WA IV, Bd. 13, S. 83.
WA I, Bd. 5/1, S. 223.
Vgl. Ernst Grumach,Goethe und die Antike. Eine Sammlung, Berlin 1949, Bd. 1, S. 246, 253, 307 f., 356 f. und 382; Hans Ruppert,Goethes Bibliothek. Katalog, Goethes Sammlungen zur Kunst, Literatur und Naturwissenschaft, Weimar 1958 [Repr. Leipzig 1978], S. 168, 171, 189, 195 und 207 f. (Nr. 1227, 1241, 1348, 1389, 1455 und 1459).—Der BandHesiods Werke und Orfeus der Argonaut ist unaufgeschnitten geblieben (Ruppert, S. 176 [Nr. 1274])—wie übrigens auch, entweder völlig oder teilweise, die Shakespeare-Übersetzungen (ebd., S. 217 f. [Nr. 1524 f. und 1531]) und die Polemik gegen Justus Perthes (ebd., S. 36 [Nr. 252]). Über weitere Bücher von Voß in Goethes Bibliothek siehe ebd., passim.
Goethe an Wilhelm von Humboldt, 16. September 1799, in:WA IV, Bd. 14, S. 181.
Goethe, „Campagne in Frankreich”, in:WA I, Bd. 33, S. 267; Ders., „Voß und Stolberg”, in:WA I, Bd. 36, S. 285; Ders., „Maximen, und Reflexionen”, Nr. 1093, in:BA, Bd. 18, S. 636.
Brief an Schiller, 21. August 1799, in:WA IV, Bd. 14, S. 161.
WA I, Bd. 33, S. 268.
Brief an Schiller, 28. Februar 1798, in:WA IV, Bd. 13, S. 83.
Brief an Zelter, 22. Juni 1808, in:WA IV, Bd. 20, S. 85.
WA I, Bd. 14, S. 305.
Goethe, Gespräch mit Sulpiz Boisserée, 19. Mai 1826, in:Gespräche, Bd. 3/2, S. 40.
Goethe, „Tag-und Jahres-Hefte 1820”, in:WA I, Bd. 36, S. 177.
Mit Recht wendet sich Bernd Witte („Goethe und Homer. Ein Paradigmenwechsel” in:Geothes Rückblick auf die Antike. Beiträge des deutsch-italienischen Kolloquiums Rom 1998, hrsg. von Bernd Witte und Mauro Ponzi, Berlin 1999, 21–37, bes. S. 21) gegen Wolfgang Schadewaldts heroisierende und harmonisierende Darstellung des Goetheschen Verhältnisses zu Homer („Goethe und Homer”, in: Schadewaldt,Goethestudien. Natur und Altertum, Zürich —Stuttgart 1963, S. 127–157).—Zu Goethes Homer-Rezeption vgl. weiterhin: Joachim Wohlleben, „Doch Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist schön. Goethe”, in: Wohlleben,Die Sonne Homers. Zehn Kapitel deutscher Homer-Begeisterung von Winckelmann bis Schliemann, Kleine Vandenhoeck-Reihe 1554, Göttingen 1990, S. 45–53; Christian-Friedrich Collatz, „Homer”, in:Wiethe-Handbuch (wie Anm. 36), Bd. 4/1, S. 494–496 volker Riedel, „Goethe und Homer”, in:Wiedergeburt griechischer Götter und Helden (wie anm. 2), S. 243–259 (auch in: Riedel, „Der Beste der Griechen” [wie Anm. 2], S. 123–143; mit weiteren Belegen und Literaturangaben).
Der junge Goethe. Neu bearb. Ausgabe, hrsg. von Hanna Fischer-Lamberg, Berlin 1963–1974 [unveränderte Neuausgabe, Berlin-New York 1999], Bd. 3, S. 75–77. (Die direkten Reminiszenzen an Homerische Wendungen sind nachgewiesen auf S. 436 f.)—In einer späteren Fassung des Gedichtes (WA I, Bd. 2, S. 178–181) hat Goethe das Direkt-Erotische gemildert.
Johann Jakob Bodmer an Schinz, 23. November 1779, in:Gespräche, Bd. 1, S. 282.
Goethe,Italienische Reise, in:WA I, Bd. 31, S. 199.
Ebd. Goethe,Italienische Reise, in:WA I, Bd. 31, S. 238 f.
Ebd., Goethe,Italienische Reise, in:WA I, Bd. 31, S. 198.
WA IV, Bd. 10. S. 127.
Schiller an Goethe, 20. Oktober 1797, in:Schillers Werke (wie Anm. 4), Bd. 28 (1969), S. 148.
AA. Epen, Bd. 2, S. 385–410.
WA I, Bd. 35, S. 78.
Vgl. Elke Dreisbach,Goethes «Achilleis», Beiträge zur neueren Literaturgeschichte 3,130, Heidelber 1994.
Vgl. Jane V. Curran, «Goethe's Helen: A Play within a Play,” in:International Journal of the Classical Tradition 7 (2000/01), S. 165–176.
«Einleitung zum Auszug aus der Ilias”, in:WA I, Bd. 41/1, S. 509.—Vgl. Tagebücher, 11. November sowie 4. und 6. Dezember 1820, in:WA III, Bd. 7, S. 247 und 255; Brief an Johann Heinrich Meyer, 9. Dezember 1820, in:WA IV, Bd. 34, S. 39; Brief an Knebel, 17. Dezember 1820. Ebd., S. 41. Vgl. auch „Tag- und Jahres-Hefte 1821”, in:WA I, Bd. 36, S. 190.
Vgl. Tagebücher, 19. und 23. März, 13. Mai sowie 6. Juni 1821, in:WA III, Bd. 8, s. 30 f., 53 und 65.
WA I, Bd. 41/1, S. 507 f. und 509 f. (irrtümlich auf den 3. November datiert). (Siehe auchBA, Bd. 18, s. 30–32;FA I, Bd. 21, S. 616–618;MA, Bd. 13/1, S. 296–298.)
WA I, Bd. 41/1, S. 266–327. (Siehe auchBA, Bd. 18, S. 32–75;FA I, Bd. 21, S. 111–130 und 209–232;MA, Bd. 13/1, S. 256–296).
Vgl. die in Anm. 60 genannten Aufsätze von Wolfgang Schadewaldt, Joachim Wohlleben und Bernd Witte.
WA I, Bd. 42/2, S. 8–12. (Siehe auchBA, Bd. 18, S. 8–11;FA I, Bd. 18, S. 195–197;MA, Bd. 3/2, S. 157–160.)—Vgl. Bernhard Suphan, „Homerisches aus Goethes Nachlaß”, in:Goethe-Jahrbuch 22 (1901), S. 9–16.
Lt. Heubeck/Hoekstra (wie Anm. 28), S. 48 ist diese Vermutung unhaltbar.
Vgl. Alfred Kappelmacher, „Goethe als Homerübersetzer und Homerinterpret”, in:Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 52 (1901), S. 1061.
Bodmer, Bd. 2, S. 127.
In der überarbeiteten Fassung von 1793 lauten die Verse:Drauf am siebenten kam ich zur lästrygonischen veste, Lamos thürmender stadt Telepylos: dort wo dem hirten Ruft eintreibend der hirt, und der austreibend ihn höret, Und wo ein mann schlaflos zwiefältigen lohn sich erwürbe, Diesen als rinderhirt, und den als hüter der schafe; Denn nicht weit sind die triften der nacht und des tages entfernet. In der Fassung von 1814 heißt es statt „der schafe”: „des wollviehs”, und der letzte Vers lautet, den Homerischen Sinn am exaktesten wiedergebend: Denn nah' ist zu des tags und der nächtlichen weide der ausgang.
WA I, Bd. 42/2, S. 9.
WA I, Bd. 42/2, S. 10–12.
So erkennt Goethe ebensowenig wie Bodmer, daß es sich bei „Lamos” nicht um eine Stadt, sondern um eine Person handelt, bezeichnet Tηλέπνλov als ein Adjektiv, das er durch „mit doppelten Toren” übersetzt, und deutet η′λν′ει nicht nur als „hören”, sondern zugleich als „gehorchen”. (Vgl. Alfred Kappelmacher [wie Anm. 79], S. 1060–1062; Otto Regenbogen, „Über Goethes Achilleis” (1942), in: Regenbogen,Kleine Schriften, hrsg. von Franz Dirlmeier, München 1961, S. 500.)
Gespräche, Bd. 1, S. 546.—Insgesamt vgl. zu Vossens Weimarer Aufenthalt im Juni 1794 die Briefe an Ernestine vom 4., 5. und 6. Juni 1794 in:Briefe, Bd. 2, S. 379–388 (Zitat: S. 386 f.); weiterhin: Karl August Böttiger,Literarische Zustände und Zeitgenossen. Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar, hrsg. von Klaus Gerlach und René Sternke, Berlin31998, S. 405–422.
Gespräche, Bd. 1, S. 577 f. und 580–583.
Vgl. Humboldts Tagebuch-Eintragung vom 21. November 1794 (Gespräche, Bd. 1, S. 583) sowie Goethes Brief an Schiller vom 27. November, dessen Brief an Goethe vom 29. November (Auszug in:Gespräche, Bd. 1, S. 583) und Goethes Brief an Schiller vom 2. Dezember 1794 (WA IV, Bd. 10, S. 208 f.;Schiller Werke [wie Anm. 4], Bd. 27 [1958], S. 95).
Vgl. Robert Steiger,Goethes Leben von Tag zu Tag, Zürich-München 1982–1996, Bd. 3 (1996), S. 348 f.
Gespräche, Bd. 1, S. 583 f.
AA. Epen, Bd. 2, 1963, S. 368–382.
WA I, Bd. 35, S. 68—Vgl. auch: “Aus denNoten zumBriefwechsel zwischen Schiller und Goethe”, in:WA I, Bd. 42/2, S. 455.
Vgl. das auf die griechischen Völker, die zur Versammlung eilen bezogene Gleichnis (II. 2,209 f.—Gespräche, Bd. 1, S. 581); Lermvoll: wie wenn die woge des weitaufrauschenden meeres Hoch an das felsengestad' anbrüllt, und die stürmende flut hallt.
Il. 2,225–243—Gespräche, Bd. 1, S. 581.
Il. 3,220—Gespräche Bd. 1, S. 582.
Gespräche, Bd. 1, S. 578.
Gespräche, Bd. 1, S. 577.
Il. 1,151—Gespräche, Bd. 1, S. 578.
\(\delta \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{\omega } \rho A\phi \rho o\delta \iota \tau \eta \varsigma \) wird von VoßIl. 3,54 durch “huld Afroditens” undIl. 3,64 durch “gaben der […] Afrodite” wiedergegeben. Vgl.Gespräche, Bd. 1, S. 582.
Il. 3,286 f.—Gespräche, Bd. 1, S. 583.
Gespräche, Bd. 1, S. 580 f.—Vgl. Anm. 113.—Vgl. auch die Kritik an Vossens Abweichungen von Homer in der Übersetzung vonIl. 3,33,75,130,180 und 362 (Gespräche Bd. 1, S. 581–583).
Il. 3,176—Gespräche, Bd. 1, S. 582.—Vgl. Stolberg, Bd. 1, S. 79.
Il. 3,39—Gespräche, Bd. 1, S. 581 f.—Vgl. Stolberg, Bd. 1, S. 74—Vgl. auch die Kritik an Vossens zu schwacher Übersetzung vonIl. 1,132 (Gespräche, Bd. 1, S. 577 f.).
Il. 1,159—Gespräche, Bd. 1, S. 577.—Vgl. auchIl. 3,180—Gespräche, Bd. 1, S. 582.
Il. 1,551—Gespräche, Bd. 1, S. 577.
Il. 1,588—Gespräche, Bd. 1, S. 577.
Gespräche, Bd. 1, S. 578.—Vgl.Il. 1,396–406.
Johann Gottfried Herder “Der entfesselte Prometheus. Szenen”, in: Herder,Sämtliche Werke, hrsg. von Bernhard Suphan, Berlin 1877–1913, Bd. 28 (1884 [Nachdr. Hildesheim 1994]), S. 329.—Vgl. auch Gleim an Herder, 14. November 1802, Ebd., S. 563.
Il. 6,1–6, 12,243 und 442–452, 13,95–110, 14,329–351 sowie 15,6 und 9 f.;Od. 7,78–131, 8,267–326 und 339–353 sowie 11,598 [?]—WA I, Bd. 4, S. 326–328, Bd. 5/2, S. 204 und 382–387 sowie Bd. 53, S. 351 (Siehe auchAA. Epen, Bd. 1, S. 311–317 und Bd. 2, S. 437–448;BA, Bd. 22, S. 266–274;FA I, Bd. 12, S. 148–154 und 1003–1024 [mit Gegenüberstellung der Übersetzungen von Voß aus dem Jahre 1793 und von Schadewaldt];MA, Bd. 6/1, S. 645–651).
Bereits It. Bernhard Suphan (wie Anm. 77, S. 6) wollte Goethe dartun, “wie manches auch nach Voß für Homer noch geschehen könne”.
Vgl. Bernhard Suphan, S. 6 f.; Alfred Kappelmacher (wie Anm. 78), S. 1057–1059; Otto Regenbogen (wie Anm. 84), S. 500.
WA I, Bd. 5/2, S. 385.—Der griechische Text lautet (Od. 8,269 f.)
WA I, Bd. 5/2, S. 386.—Bei Homer heißt es (Od. 8,292 und 295 f.)
WA I, Bd. 5/2, S. 386.—Voß ersetzt 1802 “sie beid” durch “die beiden”. V. 316 wird 1814 geändert in: “Nie zwar, hoff'ich, hinfort nur ein weniges, ruhen sie also”.—Der Homerische Text lautet (Od. 8,313–317)
Od. 8,295.—Vgl. auchOd. 8,343
WA I, Bd. 5/2, S. 386—Od. 8,321.—Vgl. Bodmer, Bd. 3, S. 103.
WA I, Bd. 5/2, S. 382—Il. 6,5 f.—Goethe: “Ajas/Brach die Reihen der Troer”; Voß: “Brach die schaar der Troer” (1802: “Brach der Troer gedräg'”).—Vgl. Bodmer, Bd. 1, S. 90: “Daß er den phalanx der Trojer brach”.—“durchbrach” bei Schadewaldt Ebener und Scheibner.
WA I, Bd. 4, S. 326—Od, 7,79.—Goethe: “die liebliche Insel”: Voß 1781: “aus Scheria's lieblichen Auen”; Voß 1793: “aus Scheria's lieblichen fluren” (1814: “aus Scheria's lieblichem eiland”).—Dagegen bei Bodmer (Bd. 2, S. 88) nur: “von Phäaziens küste”.
WA I, Bd. 5/2, S. 387—Od. 8,346.—So auch Voß 1781 und 1793. Bei Bodmer (Bd. 2, S. 103) gibt es hierfür keine Entsprechung. Die Wendung findet sich schon in KlopstocksMessias (7,632, 9,637 und 19,195); Stolberg schreibt an anderer Stelle: “mit schnellgeflügelten Worten” (Bd. 1, S. 20).
Bernhard Suphan (wie Anm. 77), S. 8 f.—Suphan glaubte, bei der Übersetzung aus dem siebenten Gesang an nur zwei Stellen eine Benutzung der Fassung von 1793 spüren zu können: Vers 78
Vgl. “gartenumgebend” und “gewitterdrohend” (V. 5,149 und 8,2 in:WA I, Bd. 50, S. 228 und 252).
V. 435, 444 und 471, in:WA I, Bd. 50, S. 286–288.—“Erderschütter” bzw.“erderschütter” bei Voß 1781 und 1793 (Od. 8,354u. ö.) sowie in Goethes Übersetzung dieses Verses (WA I, Bd. 5/2, S. 387); “erderschütterer” auch schon bei Bodmer, Bd. 2, S. 103.
V. 43, 52, 141 f., 375, 510, 569, 586, 614 und 622, in:WA I, Bd. 50, S. 272 f., 276, 284, 289 und 291 f.—Zu Goethes Übernahme des Homerischen Sprachstils in der Vossischen Version vgl. Carl Olbrich,Goethe's Sprache und die Antike. Studien zum Einfluß der klassischen Sprachen auf Goethe's poetischen Stil, Leipzig 1891, bes. S. 8 und 98–113; Friedrich Kainz, “Klassik und Romantik”, in:Deutsche Wortgeschichte, hrsg. von Friedrich Maurer und Heinz Rupp, 3., neu bearb. Aufl., Bd. 2, Grundriß der germanischen Philologie 17/2, Berlin-New York 1974, S. 271 f.; Häntzschel, S. 256 f.
V. 39, 122 und 227, in:WA I, Bd. 50, S. 272, 275 und 279.—Vgl. schon “Hermann und Dorothea” 2,42, 4,1, 4,250 u. ö, in:WA I, Bd. 50, S. 199, 213, und 222.
V. 18, in:WA I, Bd. 50, S. 271—Il. 4,164 und 6,448.—Vgl. dagegen Bodmer (Bd. 1, S. 55): “Ja er wird kommen der tag”; Stolberg (Bd. 1, S. 99): “es kommet/Einst ein Tag”.
V. 14, in:WA I, Bd. 50, S. 271—Il. 24,788.—Vgl. dagegen Bodmer (Bd. 1, S. 411): “mit der farbe der rose”; Stolberg (Bd. 2, S. 432): “die frühgebohrne Morgenröthe”.
V. 17, in:WA I, Bd. 50, S. 271.—DagegenHermann und Dorothea 5,89, Ebd.,S. 226.
WA IV, Bd. 12, S. 118.
Gespräche, Bd. 1, S. 903.
WA I, Bd. 48, S. 20 und 60.
Vgl. Jane V. Curran, “Wieland's Revival of Horace”, in:International Journal of the Classical Tradition 3 (1996/97), S. 181–184.
WA I, Bd. 7, S. 235–237.
WA I, Bd. 7, S. 239.
Vgl.Weltliteratur. Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes, Ausstellung und Katalog: Reinhard Tgahrt, Marbacher Kataloge 37, Marbach 1982, S. 269–295; Manfred Fuhrmann, “Von Wieland bis Voß: Wie verdeutscht man antike Autoren?”, in:Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1987, S. 1–22.
Brief an Knebel, 10. März 1813, in:WA IV, Bd. 23, S. 296.
Eckermann, S. 305 (8. April 1829).
WA I, Bd. 28, S. 73.
Vgl. Wilhelm Grimm and Jacob Grimm, 14. Oktober 1815, in:Gespräche, Bd. 2, S. 1101.
Brief an Zauper, 6. August 1823, in:WA IV, Bd. 37, S. 159.
WA I, Bd. 40, S. 329 f.
Vgl.Das Problem des Übersetzens, hrsg. von Hans Joachim Störig, Wege der Forschung 8, Darmstadt 1963, S. 35–37.
Vgl. einerseits Häntzschel, S. 227 f.—andererseits Reinhard Tgahrt in:Weltliteratur (wie Anm. 133), S. 270; Manfred Fuhrmann, “Übersetzungen antiker Autoren”, in:Die Antike in der europäischen Gegenwart, hrsg. von Walther Ludwig, Veröffentlichung der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg 72, Göttingen 1993, S. 24 f. (vgl. auch Ders., “Die gute Übersetzung: Was zeichnet sie aus, und gehört sie zum Pensum des altsprachlichen Unterrichts?”,Der altsprachliche Unterricht 35 [1992] 1, S. 18f.=Ders.,Caesar oder Erasmus? Die alten Sprachen jetzt und morgen, Promenade 3, Tübingen 1995, S. 197f.); Jane V. Curran (wie Anm. 130), S. 172 F. (Currans Hinweis auf die späteren Ausführungen bleibt völlig pauschal.)
Manfred Fuhrmann, “Goethes Übersetzungsmaximen,” in:Goethe-Jahrbuch 17 (2000), S. 26–46, bes. S. 30–33.
Albert Fries, “Goethes Schema zur Ilias”, in:Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, Nr. 126, 21. Oktober 1902, S. 501 f.—Vgl. die Referierung der wichtigsten Ergebnisse in: Elke Dreisbach (wie Anm. 70), S. 168 f.
Brief an Knebel, 17. Dezember 1820, in:WA IV, Bd. 34, S. 41.
Vgl.AA. Epen, Bd. 2, S. 385—WA I, Bd. 41/1, S. 268–270.
Vgl. die Briefe an Knebel vom 17. Dezember 1820 und 18. Februar 1821 sowie die Briefe an Karl Ernst Schubarth vom 12. Januar und 22. Mai 1821, in:WA IV, Bd. 34, S. 41, 95 f., 133 f. und 254.
WA I, Bd. 41/1, S. 507 und 509.
Am deutlichsten ist Vossischer Einfluß in V. 61 zu spüren: “Itzt eröffneten heftig des Himmels Pforte die Horen” (WA I, Bd. 50, S. 273); im Schema zurIlias hieß es: “Die Horen eröffnen die Thore des Olympos” (AA. Epen, Bd. 2, S. 397; ebensoWA I, Bd. 41/1, S. 277)— beides in Anlehnung an Vossens Übersetzung vonIl. 5,749–751 (in der allerdings, ebenso wie bei Homer, die Horen als Torhüterinnen des Olympsnicht einzugreifen brauchten, weil die Tore von selbst aufsprangen).
Das Exemplar derOdyssee hat ein Titelblatt mit dem Namenszug August von Goethes und Deckblätter mit den Namen Ottiliens und Wolfgang von Goethes.—Vgl. Bernhard Suphan (wie Anm. 77), S. 8.
Vgl. Goethes Brief an Christiane vom 7. Oktober 1814 (WA IV, Bd. 25, S. 54).
Vgl. Hans Ruppert,Goethes Bibliothek (wie Anm. 50), S. 177 (Nr. 1279 f.).—Ebd., S. 177–181 generell über Homer-Ausgaben und-Übersetzungen sowie über Sekundärliteratur zu Homer in Goethes Bibliothek.—Die Vossische übersetzung wird in dem Abschnitt über denIlias-Auszug nach der Ausgabe von 1814 zitiert; gegebenenfalls werden Abweichungen gegenüber denen von 1793 und 1802 verzeichnet.—Ich möchte der Stiftung Weimarer Klassik meinen Dank dafür aussprechen, daß sie mir die Einsicht in die Exemplare der Vossischen Homer-Übersetzung in Goethes Bibliothek gestattet hat.
WA I, Bd. 41/1, S. 271—Il. 3,33.—Bei Voß: «natter.”.—Stolberg (Bd. 1, S. 66) und Bodmer (Bd. 1, S. 38) hatten mit «Drachen» übersetzt.
WA I, Bd. 41/1, S. 291 und 309—Il. 12,42 und 17,725.—Bei Voß: «waldschwein».—stolberg (Bd. 1, S. 306) hatte mit «Keuler» und Bodmer (Bd. 1, S. 188) mit «Eberschwein» übersetzt.
WA I, Bd. 41/1, S. 271—Il. 3.24.—Bei Voß: «gemsbok». Stolberg (Bd. 1, S. 74) hatte mit «Gemse» übersetzt.
WA I, Bd. 41/1,. S. 305—Il. 16.757.—«getödtete Hindin» auch bei Stolberg (Bd. 2, S. 117).— Vgl. auch bei Voß «axt» und «zimmerer» sowie bei Goethe «Axt» und «Zimmermann» (WA I, Bd. 41/1, S. 271—Il. 3,60 f.).
WA I, Bd. 41/1, S. 314—Il. 20,166.
WA I, Bd. 41/1, S. 271—Il. 3,151.
WA I, Bd. 41/1, S. 290—Il. 7,63.
WA I, Bd. 41/1, S. 293—Il. 13,39—Vgl. auch bei Voß: «wie ein stier er/Stöhnete», und bei Goethe: «Gleichniß vom stöhnenden Stier» (WA, Bd. 41/1, S. 315—Il. 20,403–405).
WA I, Bd. 41/1, S. 319—Il. 22,134 f.
WA I, Bd. 41/1, S. 269 (Hervorhebungen hier und im folgenden: V. R.)—Il. 2,394–397.— Auch Stolberg (Bd. 1, S. 51) und Bodmer (Bd. 1, S. 32) hatten mit «Felsen» bzw. «fels, der hervorragt» übersetzt.
WA I, Bd. 41/2, S. 270—Il. 2,471.—Auch Stolberg (bd. 1, S. 54) hatte mit «Bütten» übersetzt, während Bodmer (Bd. 1, S. 34) von «eimern» sprach.
WA, Bd. 41/2, S. 273—Il. 4,275 und 279.—Voß 1793: «treibt».—Auch Stolberg (bd. 1, S. 103) hatte mit «Geishirt» übersetzt, danach aber «Höhle» gewählt.
WA I, Bd. 41/1, S. 286 f.—Il. 10,183 f.—Voß 1793: «Hörend des wutgebrüll des unthiers».
WA I, Bd. 41/1, S. 274—Il. 5,5.
WA I, Bd. 41/1, S. 306—Il. 17,109–112.—«unwillig» auch Stolberg (Bd. 3, S. 127).
WA I, Bd. 41/1, S. 317—Il. 21,252 f.—Vgl. auch weitere derartige Übereinstimmungen: «Gleichniß vom Stier, derauf der Weide vor allenRindern hervorragt»—«denn er [der stier] ragt aus den rindern hervor auf der weide» (WA I, Bd. 41/1, S. 270—Il. 2,480 f.); «Gleichniß vongeworfelten Bohnen, die von derSchaufel herab fallen»—«Wie von der breiten schaufel herab […]/Hüpfet der bohnen frucht […]/Unter […] dem schwunge des worflers» (WA I, Bd. 41/1, S. 212 f.—Il. 13,588–590; Voß 1793 und 1802: «dem mächtigen schwunge»); «Gleichniß der streitendenHabichte, diesich hochauf luftigen Felsen bekämpfen»—«Beide den habichten gleich, […]/Die auf luftigem fels mit tönendem schrei sich beämpfen», (WA I, Bd. 41/1, S. 303—Il. 16,429 f; Voß 1793: ‘mit wildem getön»); «Gleichniß vom Traum, wo derFliehende nichtentfliehen, derVerfolger nicht einholen kann»—«Wie man im traum machtlos den fliehenden strebt zu verfolgen;/Nicht hat dieser die macht zu entfliehn, noch der zu verfolgen» (WA I, Bd. 41/1, S. 320—Il. 22,199 f.; Voß 1793 und 1802: «statt «machtlos»: «umsonst»; Voß 1793: «Nicht kann dieser hinweg ihm entfliehn, und jener verfolgen»).
WA I, Bd. 41/1, S. 279—Il. 6,506–510.—Voß 1793: «Wie wenn im stall ein roß, mit gerste genährt an der krippe». Sowohl die Wendung «Stallroß» als auch das Attribut «wohlge-füttert» weisen auf die Fassung von 1802 hin.—Stolberg, (Bd. 1, S. 172) hatte ebenfalls Wörter und Wendungen wie «Roß», «Banden», «zum gewohnten Bade des lauterwallenden Stromes», «Haupt» und «Mähnen» gewählt.
WA I, Bd. 41/1, S. 204—Il. 9,4–7.—Die Vossische Übersetzung von 1793 hat hiervon einige Abweichungen, benutzt aber dieselben Schlüsselwörter.—Auch Stolberg (Bd. 1, S. 219) verwendet bereits das Wort «Meergras».
WA I, Bd. 41/1, S. 317—Il. 21,362–364.—Stolberg (Bd. 2, S. 233): «ein Kessel […],/Voll vom schmelzenden Fette des wohlgepflegeten Mastschweins».
WA I, Bd. 41/1, S. 319—Il. 21,573–577.—Voß hier nach der Fassung von 1793 zitiert; seit 1802 schreibt er statt «aus tiefverwachsenem dickicht»: «aus tiefverwachsener holzung».— Das Wort «Pardel» findet sich schon bei Stolberg (Bd. 2, S. 240), während Bodmer (Bd. 1, S. 351) «pantherthier» wählte.—Vgl. auch weitere derartige Übereinstimmungen: «Gleichniß vomentsetzlichen Waldbrande, wo der Sturmim dürren Gebirg durchdie gewundenen Thäler dieFlammenwirbel herumtreibt»—«Wie ein entsezlicher brand die gewundenen thale durchwütet,/Hoch im dürren gebirg'; […]/Und rings wehet der wind mit sausenden flammenwirbeln» (WA I, Bd. 41/1, S. 315—Il. 20,490–492); «Gleichniß vomwässernden Mann der […]aus der Rinne Schutt wegräumt» und vom Wasser, das «dem Leitenden selbstzuvoreilt»—«ein wässernder mann», der «den schutt wegräumt aus der rinne», das Wasser «eilet zuvor auch dem führer» (WA I, Bd. 41/1, S. 317—Il. 21,257–261; Voß 1793 mit Abweichungen, aber denselben Schlüsselwörtern); «Gleichniß vomNordwind, der einen imHerbst gewässerten Garten […]austrocknet»—«Wie wenn in herbstlicher schwüle der nord den gewässerten garten/[…] austroknet» (WA I, Bd. 41/1, S. 317—Il. 21,346 f.); «Gleichniß von derschüchternen Taube, welche,vom Habicht verfolgt, Felsritzen sucht»—«wie die schüchterne taube,/Welche, vom habicht verfolgt, in den höhligen felsen hineinfliegt» (WA I, Bd. 41/1, S. 318—Il. 21,492 f.).
WA I, Bd. 41/1, S. 319—Il. 22,22 f.
WA I, Bd. 41/1, S. 319—Il. 22,93–95.
WA I, Bd. 41/1, S. 320—Il. 22,189–192.—«sich windend» ist von Goethe falsch bezogen.
WA I, Bd. 41/1, S. 320 f.—Il. 22,308–310.
WA I, Bd. 41/1, S. 302—Il. 16,212 f.
WA I, Bd. 41/1, S. 295—Il. 13,492 f.
WA I, Bd. 41/1, S. 288—Il 10,485.—Bei Voß: “das ungehütete kleinvieh”.—Stolberg (Bd. 1, S. 265) übersetzte mit “ungehütete Heerden”.
WA I, Bd. 41/1, S. 294—Il. 13,180.—Voß: “zartes gesproß”.
WA I, Bd. 41/1, S. 270—Il. 3,10.—Bei Voß: “felskuppen”.
WA I, Bd. 41/1, S. 302—Il. 16,259–265.—Bei Goethe “gereizt”, bei Voß 1802, “reizend” und 1793 “kränkend”.
WA I, Bd. 41/1, S. 316—Il. 21,12 f.
WA I, Bd. 41/1, S. 320—Il. 22,139–142.—Bereits Stolberg (Bd. 1, S. 250) schrieb. “wie ein Falk im Gebirge”.—Vgl. auch das bereits zitierte “Gleichniß vom wohlgefütterten Stallrosse” (ob. S. 556).
WA I, Bd. 41/1, S. 303—Il. 16,297–300.—Voß 1793: Wie wenn hoch vom ragenden haupt des großen gebirges Dickes gewölk fortdrängt der donnerer Zeus Kronion; Hell sind rings die warten der berg', und die zackigen gipfel, Thäler auch; aber am himmel eröfnet sich endlos der äther.
WA I, Bd. 41/1, S. 303—Il. 16,406–408.
WA I, Bd. 41/1, S. 267—Il. 1,497.—Goethe sind bei seiner Wiedergabe derIlias zweimal Irrtümer hinsichtlich der Personen unterlaufen: Bei ihm tötet Melanthios den Eurypylos, bei Homer Eurypylos den Melanthios (WA I, Bd. 41/1, S. 278—Il. 6,36), und er verwechselt Panopeus und dessen Sohn Epeios (WA, Bd. 41/1, S. 324—Il. 23,664 f.).Eine Formulierung (die sich im übrigen ebenfalls an Voß anlehnt) ist mißverständlich: Goethe schreibt über Patroklos, der weinend zu Achilleus tritt: “vergleichbar derfinstern Quelle, die aus Felsenspalten im düstern Raume indunkles Wasser fällt” (WA I, Bd. 41/1, S. 301). Bei Homer gießt die Quelle das Wasser den Felsen hinab, und Voß hatte korrekt geschrieben: “der finsteren quelle vergleichbar,/Die aus jähem geklipp vorgeußt ihr dunkles gewässer” (Il. 16,3 f.; Voß 1793; “geklipp' hergeußt”).—Vgl. auch Anm. 148.
V. 12, in:WA I, Bd. 50, S. 229.
V. 8544, 8549, 8577, 8588, 8627, 8638, 8671, 8718, 8720, 8748, 8776 f., 8783, 8801, 8840, 8845, 8894, 8896, 8939, 9014 und 9221, in:WA I, Bd. 15/1, S. 179, 180, 182 f., 185–188, 190, 193, 196, 203 und 208.—Vgl. Friedrich Kainz (wie Anm. 122), S. 272 sowie die entsprechenden Lemmata im Grimmschen und im Goethe-Wörterbuch.
V. 8571–8577 und 8587, in:WA I, Bd. 15/1, S. 180; V. 8674–8686, in:WA I, Bd. 15/1, S. 184—Od. 21,5–10; V. 8702 f., in:WA I, Bd. 15/1, S. 185—Il. 5,784–786 sowie 859–861 u. ö.; V. 8703, in:WA I, Bd. 15/1, S. 185—Il. 11,10; V. 8821, in:WA I, Bd. 15/1, S. 189—Od. 11,24–50; V. 8999 f., in:WA I, Bd. 15/1, S. 199—Od. 11,13–19; V. 9014 f., in:WA I, Bd. 15/1, S. 199—Il. 22,346 f.—Vgl. die Kommentare inBA, Bd. 8;FA I, Bd. 7/2;MA, Bd. 18/1;Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bdn. hrsg. von Eduard von der Hellen, Stuttgart-Berlin 1902–1907, Bd. 14 (1906); Goethe,Werke. Jubiläumsausgabe, Bd. 3, Frankfurt a. M.—Leipzig 1998.
V. 8552, in:WA I, Bd. 15/1, S. 179—Od. 4,75.—Voß 1781: “Schaz”, 1793: “schaz”.
V. 8551 und 8773, in:WA I, Bd. 15/1, S. 179 und 187—Il. 6,381 und 24,302 sowieOd. 2,345 u. ö.—Voß 1781: “Schaffnerin”, 1793: “schafnerin”.—Das Wort “Schaffnerin” hatte auch schon Stolberg verwendet (Bd. 1, S. 167 und Bd. 2, S. 414), während Bodmer “kammerfrau” oder “der frauen eine, die ihn bedienten” übersetzte oder die Bezeichnung völlig wegließ (Bd. 1, S. 100 und 398; Bd. 2, S. 34).
V. 8927–8929, in:WA I, Bd. 15/1, S. 195—Od. 22,462 f., 468 f. und 471–473.—Voß 1793: Nicht mit reinem tode fürwahr vertilg' ich das leben Jener […]. Und wie ein fliegender zug der drosseln oder der tauben Oft in die schling' einstürzt […]: Also hingen sie dort an einander gereiht mit den häuptern, Alle die schling' um den hals, des kläglichsten todes zu sterben; Zappelten dann mit den füßen […] 1814 heißt es statt “vertilg' ich das leben/Jener”: “soll der odem geraubt sein/Diesen”, und nach “drosseln” und “tauben” steht (wie schon 1802) ein Komma. Die Wendung “Sie stirbt einen edlen Tod” erinnert am stärksten an die Fassung von 1781.—Die Anklänge an Voß (vgl. hierzu Horst Rüdiger, “Weltliteratur in GoethesHelena”, in: Rüdiger,Goethe und Europa. Essays und Aufsätze 1944–1983, Berlin-New York 1990, S. 98) wirken aus heutiger Sich weniger stark, weil auch die neueren Übersetzer Homer auf ähnliche Weise wiedergeben; Scheibner: “mit einem ehrlichen tod”/“Wie wenn Drosseln […] oder Wildtauben […] in eine Schlinge geraten”/“zappelten”. Ebener: “eines ehrlichen Todes”/“Drosseln”/ “zappelten mit den Beinen”. Schadewaldt: “reiner Tod”/“Drosseln”/“zappelten”. Der Vergleich mit Bodmer (Bd. 2, S. 287 f.) aber bestätigt die Übereinstimmung der Vossischen und der Goetheschen Wortwahl: die dirnen […] sie sollen Nicht durch das schwerdt des schönern todes sterben. […] Wie wenn dauben die flügel in einem netze verwickeln, […] Also hiengen sie an dem tau, den strick um den nacken, Ueber dem tau die köpf' in einer schliessenden reihe; Starben da kläglich, sie schlugen die luft mit bebenden füßen.
Od. 22,474–477.
V. 9054–9058, in:WA I, Bd. 15/1, S. 201 f.—Verg.Aen. 6,494–497.
So in Franz Fühmanns ErzählungDas Netz des Hephaistos.—Vgl. Volker Riedel, “Die Antike im Werk Franz Fühmanns”, in: Riedel,Literarische Antikerezeption (wie Anm. 2), S. 268.
Eckermann, S. 560 (7. Oktober 1827).
Author information
Authors and Affiliations
Additional information
Vortrag vom 18. September 2002 am Goethe-Museum Düsseldorf.
Goethes Werke und Briefe werden, mit der SigleWA, nach der Weimarer Ausgabe (Goethes Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, Weimar 1887–1919) zitiert. Für die in dieser Ausgabe mehr oder weniger ‘versteckt’ veröffentlichten Schriften, die für Goethes Beziehung zu Homer und zu Voß aber besonders relevant sind, werden auch die bibliographischen Angaben nach der Akademie-Ausgabe (Werke Goethes, hrsg. vom Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin 1952–1986), der Berliner Ausgabe (Berlin-Weimar 1960–1978), der Frankfurter Ausgabe (Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bibliothek Deutscher Klassiker, Frankfurt a. M. 1985 ff.) und der Münchner Ausgabe (Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, hrsg. von Karl Richter, München 1985–1998) genannt—und zwar mit den SiglenAA, BA, FA undMA. In derWA nicht enthaltene Texte werden nach derAA zitiert.
Für die Gespräche Goethes und für zeitgenössische Zeugnisse wurden folgende Ausgaben benutzt:Goethes Gespräche. Eine Sammlung zeitgenössischer Berichte aus seinem Umgang, auf Grund der Ausgabe und des Nachlasses von Flodoard Freiherrn von Biedermann ergänt und hrsg. von Wolfgang Herwig, Zürich-Stuttgart 1965–1987 (Gespräche); Johann Peter Eckermann,Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, hrsg. von Regine Otto unter Mitarb. von Peter Wersig, Berlin-Weimar 1982 (Eckermann).
Die Schriften von Voß werden, soweit möglich, nach folgenden Ausgaben zitiert:Ausgewählte Werke, hrsg. von Adrian Hummel, Göttingen 1996(AW); Briefe. Nebst erläuternden Beilagen hrsg. von Abraham Voß, Halberstadt 1829–1833 [Repr. Hildesheim-New York 1971] (Briefe). Seine Homer-Übersetzung wird mit den Siglen, “Voß 1781”, “Voß 1793”, „Voß 1802” und „Voß 1814” bezeichnet (vgl. Anm. 15). Mit der Sigle, „Häntzschel” wird zitiert: Günter Häntzschel,Johann Heinrich Voß. Seine Homer-Übersetzung als sprach-schöpferische Leistung, Zetemata 68, München 1977.
Homer-Zitate sind nach folgenden Ausgaben wiedergegeben:Homeri Opera recogn. brevique adn. crit. instrux. David B. Monro et Thomas W. Allen, Tomus I–II:Ilias, ed. tert., Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis, Oxonii 1920 [Repr. 1945 f.];Homeri Odyssea recogn. P. von der Muehll, ed., stereot. ed. tert. (1962), Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae 1984.
Bei Übersetzungen wird in der Regel auf Band- und Seitenzahlen sowie auf die Angabe einer geringfügig abweichenden Verszählung verzichtet; nur bei den Übersetzungen von Bodmer und Stolberg, die keine oder eine mitunter stärker abweichende Verszählung haben, werden Band- und Seitenzahlen angegeben (vgl. Anm. 10). An neueren Übersetzungen werden gelegentlich herangezogen: Homer,Werke in zwei Bänden. Aus dem Griech. übertr. von Dietrich Ebener, Bibliothek der Antike, Berlin-Weimar 1971; Homer,Ilias. Neue Übertr. von Wolfgang Schadewaldt, Frankfurt a. M. 1975=insel taschenbuch 1975; Homer,Die Odyssee Deutsch von Wolfgang Schadewalt, 162–164. Tsd., Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft 29=Griechische Literatur 2, Hamburg 1993; Homer,Ilias. Aus dem Griech. in Prosa übertr. von Gerhard Scheibner, Berlin-Weimar 1972; Homer,Odyssee. Aus dem Griech. in Prosa übertr. von Gerhard Scheibner, Berlin-Weimar 1986.
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Riedel, V. Ein, “Grundschatz aller Kunst”: Goethe und die Vossische Homer-Übersetzung. Int class trad 8, 522–563 (2002). https://doi.org/10.1007/BF02901556
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02901556