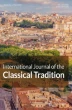Abstract
This is the first comprehensive study of the importance of classical reminscences to Turgenev’s character portrayal (this main concern can even be found in his enthusiastic reaction to the Pergamum Altar). After discussing particular phenomena such as the use of classical quotations as euphemisms and the practice of evoking classical prototypes to enhance or dismantle modern heroes, the author dwells on Turgenev’s use of entire classical works as “subtexts” to his novels. The influence of Homer, Virgil, or Catullus is not limited to individual passages but extends to plot, theme, and structure. In his approach to intertextuality on a larger scale, Turgenev neither slavishly imitates his models nor naïvely competes with them. The result is strikingly modern: instead of Aeneas, we find an anti-hero; instead of anIliad, a novel on the eve of an heroic action.
Similar content being viewed by others
References
Ausgaben:Polnoe sobranie soèinenij I. S. Turgeneva, 12 Bde., St. Petersburg 1898 (hier mit aufrechten Zahlen zitiert). I. S. Turgenev,Polnoe sobranie soèinenij v 28 tomach, darin:Soèinenija v 15 tomach, Moskau und Leningrad 1961–1968 (hier mit kursiven Zahlen zitiert);Briefe: I. S. Turgenev,Pis’ma, 13 Bände (Bd. 12 und 13 jeweils zweigeteilt), Moskau und Leningrad 1961–1968. Alle Übersetzungen aus dem Russischen stammen vom Verf. dieses Aufsatzes.
Briefe Bd. 12,2 (1879–1880) 1967, S. 59.
Der vorliegende Aufsatz ist ganz aus erster Hand geschöpft und beruht auf einer selbständigen Durcharbeitung der Originalquellen. Eine zusammenfassende Untersuchung zu unserem Thema ist mir bisher nicht bekannt. Selbstverständlich finden sich in der internationalen Forschungsliteratur gelegentlich punktuelle Hinweise; ein sehr knapper Überblick z. B. bei F. F. Seeley,Turgenev. A Reading of his Fiction, Cambridge 1991, S. 76–77; 80; 240 mit den zugehörigen Anmerkungen. Weiteres wird im folgenden zitiert, soweit es für unsere überwiegend hermeneutische und methodologische Fragestellung von Belang ist. Die Hauptabsicht des vorliegenden Aufsatzes ist es, über vereinzelte Quellennachweise hinauszugelangen und die künstlerischen Absichten des Autors sowie die Bedeutung intertextueller Bezugnahmen für seine dichterischeinventio und für die Gattungsproblematik seiner Romane herauszuarbeiten. Der Aufsatz setzt damit die bisher vom Verfasser vorgelegten Untersuchungen fort, in denen es um die semantische Funktion intertextueller Bezüge in Werken russischer Dichter geht: M. von Albrecht,Rom: Spiegel Europas. Das Fortwirken antiker Texte und Themen in Europa, 2. Aufl., Tübingen 1998, S. 207–278: “Antike Elemente in Puškins Sprache und Stil”; 433–469: “Der verbannte Ovid und die Einsamkeit des Dichters im frühen XIX. Jahrhundert. Zum Selbstverständnis Franz Grillparzers und Aleksandr Puškins”; 493–514: “Torquato Tasso, Goethe und Puškin als Leser und Kritiker der Liebeslehre Ovids”; 571–642: “Zur Selbstauffaussung des Lyrikers. Horaz (carm. 2, 20 und 3, 30)—Ronsard—Du Bellay—Sarbievius—Deržavin—Puškin—Block—Jevtušenko”; M. von Albrecht,Der Mensch in der Krise. Aspekte augusteischer Dichtung, Freiburg 1981, bes. 16–39: “Horazens Pompeius-Ode (2, 7) und Puškin”.
Z. B. Bd. 9, S. 299–300.
Briefe Bd. 3 (1856–1859) 1961, S. 333.
Über die Berliner Altertumswissenschaft jener Zeit siehe z. B. M. Eerbe, Hrsg.,Berlinische Lebensbilder: Geisteswissenschaftler, Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 60, Berlin 1989, bes. S. 37–54: H. Schneider, “August Boeckh”; vgl. auch das zweibändige Werk zur DAI-AusstellungBerlin und die Antike, Berlin 1979, bes. den BandAufsätze, hrsg. von W. Arenhövel u. C. Schreiber, S. 9–67: W. Unte, “Berliner Klassische Philologen im 19. Jahrhundert” (S. 15 ff. zu Boeckh, S. 24 f. zu Zumpt).
S. z. B. sein GedichtAn die Venus Medici (9, 238–240).
Briefe, Bd. 3 (1856–1859) 1961, S. 333.
Natürlich nach westeuropäischen Vorbildern: W. Müller-Lauter, in:Historisches Wörterbuch der Philosophie 6 (1984) S. 846, s. v.; W. Goerdt, ebd. 854f. Vgl. jetzt auch A. M. Kelley,Toward Another Shore. Russian Thinkers Between Necessity and Chances, New Haven & London 1998, S. 91–118: “The Nihilism of Ivan Turgenev.”
Den Horaz kannte Turgenev sehr genau; arbeitete er doch intensiv an der Horaz-Übersetzung seines Freundes Feth mit, korrigierte dessen Fehler (und ließ die Übersetzung sogar auf eigene Kosten drucken):Briefe, Bd. 2 (1851–1865) 1961, S. 163f.; 198ff.; 212 (Feth beharrt auf slawischen Wörtern, die Turgenev stören); 217; 242; 259; 294 (letzte Korrekturen vor dem Druck); 332 und 386 (Widmung an den Zaren); 339 (3. Buch des Horaz). Abgesehen von bekannten Stellen wienon omnis moriar (Horazcarm. 3, 30, 6; in Rußland von Puškin und anderen nachgeahmt), die in seinen Texten so selbstverständlich mitschwingen, daß ein ausdrückliches Zitat sich erübrigt (12, 79 über Zagoskin: “Er hörte von mir, daß er nicht ganz gestorben war”), findet sich auch Erlesenes wieilli et aes triplex et robur (Briefe, 13, 2 [1880–1882], 1968, S. 16; nach Horaz,carm. 1, 3, 9).
Eine halb ironische Anspielung auf Sokrates auchBriefe, Bd. 1 (1831–1850), 1961, S. 325:le dernier geste de Socrate mourant (über einen Bauern, dem das Getreide verhagelt wurde).
Ebenso spöttelt Turgenev über tautologische halbphilosphische Phrasen, die er durch ein lateinisches Zitat aus Molière illustriert:opium facit dormire quare est in eo virtus dormitiva (12, 23; 14, 28, Fußnote).
G. Büchmann,Geflügelte Worte. Neu bearb. und hrsg. von H. M. Elster, Stuttgart, 2. Aufl. 1966, 465 f.
In der neuen Ausgabe nicht enthalten (wohl wegen Zweifels an der Echtheit).
Eine ähnlich unerwartete Übertragung eines Zitats aus dem Erotischen ins Politische findet sich ebenfalls in dem Artikel über die Begegnung mit Palmerston, dessen Popularität Turgenev mit dem Vergilwortveteris vestigia flammae umschreibt (Vergil,Aeneis 4, 23).
Vgl. Sophokles,Antigone 1023 f.; Euripides,Hippolytos 615; Cicero,Philippicae 12, 5 u. a.
In VergilsAeneis tötet sich Dido mit einem Schwert, das Aeneas ihr geschenkt hat; der Anblick des Wehrgehenks, das Turnus dem getöteten Pallas geraubt hat, erinnert Aeneas an seine Rachepflicht, usw.
W. Schadewaldt, “Die Wappnung des Eteokles”, in:Eranion. Festschrift für H. Hommel, Tübingen 1961, S. 105–116, bes. 106 (wieder abgedruckt in Ders.,Hellas und Hesperien. Gesammelte Schriften zur Antike und zur neueren Literatur I.Antike und Gegenwart, Zürich und Stuttgart 1970, S. 357–369, bes. 358).
Siehe unten, Anm. 39.
Auf derselben Seite findet sich folgende Bemerkung: “Puškin verdient die Bezeichnung eines dem Geiste nach antiken Dichters viel eher als ... André Chénier”.
Homer,Ilias Z 506–511 (=O 263–268), Ennius,Annales 514–518 V2.; Vergil,Aeneis 11, 492–497; Apollonios Rhodios 3, 1259–1262; vgl. M. von Albrecht, “Ein Pferdegleichnis bei Ennius”,Hermes 97 (1969), S. 333–345; Turgenev scheint seinerseits auf Tolstoj ausgestrahlt zu haben (Krieg und Frieden 1, 3, 4, Moskau 1897, S. 365).
Platon,Parmenides 136e–137a: “Da habe nun Parmenides erwidert: So muß ich euch denn nun nachgeben, wiewohl ich fürchte, daß es mir ebenso ergehen wird wie dem Rosse bei Ibykos, das zwar wohlgeübt im Wettkampfe, aber doch schon etwas bei Jahren, wenn es das Wagenrennen noch einmal bestehen soll, eben vermöge seiner Erfahrung vor dem Erfolge zittert, und dem er sich selbst vergleicht, indem er singt, daß ebenso auch er, so alt schon, wider seinen Willen gezwungen werde, von neuem die Rennbahn der Liebe zu betreten”. (Übersetzung von F. Schleiermacher).
Dasselbe Zitat findet sich auchBriefe 13, 2 (1880–1882) 1968, S. 189.
Ein weiterer Hinweis auf Cicero findet sich in einem Brief an Feth (Briefe 4 [1860–1862] 1962, S. 108) über die Freuden des Alters inDe senectute. Ein Brief an einen Freund (Briefe Bd. 4 [1860–1862] 1962, S. 163) schließt mit den Wortenvale et me ama und dem ausdrücklichen Zusatz: “Cicero pflegte so seine Briefe zu schließen”.
In dem RomanAm Vorabend wird der Held, der für Bulgariens Freiheit kämpfen will, mit Brutus (2, 357; 8, 141) und mit Themistokles am Vorabend der Schlacht von Salamis verglichen (2, 277; 8, 64). Diese Stelle hat zugleich die wichtige Funktion, den Buchtitel zu erklären (wir kommen in Abschnitt VI auf sie zurück). Der RomanRudin zieht Parallelen zwischen dem Haupthelden und Demosthenes (4, 365; 6, 299), während Pigasov als neuer Aristophanes und Ležnev als Diogenes stilisiert sind.
Nicht aus Livius, sondern aus Plutarch (Pyrrhos 14, 4–16) stammt freilich die Anekdote über Cineas und PyrrhusBriefe 12, 1 (1876–1878) 1967, S. 376.
Das Kreuz als Schmuckstück wandert von Gemma zu Sanin und wieder zu ihr (als Hochzeitsgeschenk für ihre Tochter, die gleich Lavinia als Trägerin der Zukunft erscheint).
Briefe, Bd. 1 (1831–1850) 1961, S. 356
Briefe, Bd. 10 (1872–1874), 1965, S. 140.
Briefe, Bd. 10, S. 152.
Um der Deutlichkeit willen hat Turgenev hier den Worlaut leicht, aber keineswegs sinnstörend verändert.
Die Fortsetzung lautet: “Ovid las ich, um mit dem jungen Viardotetwas Latein zutreiben [die kursivierten Worte stehen auch im Original deutsch]. Auch er ist nicht so schlecht wie Sie schreiben” (An Feth, 13./25. September 1873).
Briefe, Bd. 10, S. 213.
Briefe, Bd. 10, S. 213
Briefe, Bd. 9 (1871–1872) 1965, S. 156–157.
Briefe, Bd. 9 (1871–1872) 1965, S. 137.
Briefe, Bd. 9, S. 109.
Briefe, Bd. 9, S. 276; 324.
Briefe, Bd. 1 (1831–1850) 1961, S. 194 (1840): Turgenev bedauert, seinen Homer nicht (wie sonst) mitgenommen zu haben (Voß wird erwähnt). Wiederholt empfiehlt erals Lektüre Goethe, Homer und Shakespeare:Briefe, Bd. 4 (1860–1862) 1962, S. 9; Bd. 12, 1 (1876–1878) 1966, S. 288; vgl. 217; er entnimmt Homer einzelne treffende Ausdrücke: “la mer ’qui bruit au loin’ comme dit Homère”: Briefe, Bd. 7 (1867–1869) 1964, S. 297; eine recht freie-von Turgenev deutsch formulierte—Paraphrase im daktylischen Rhythmus ist: “O armes Menschengeschlecht, dem Laube des Waldes vergleichbar”:Briefe, Bd. 8 (1869–1870) 1964, 102.
Die Tatsache, daß Insarov und Elena ihre Ehe am Vorabend der Hochzeit vollziehen, genügt nicht, um den Titel des Romans zu erklären und löst auch nicht das Problem der Schuld. Elenas Gewissensbisse entspringen nicht ihrer Liebe zu Insarov, sondern ihrer Unaufrichtigkeit gegenüber ihren Eltern. Wichtig ist ferner der Umstand, daß der bulgarische Held seinem Prinzip untreu wird, “nie ein russisches Mädchen zu lieben”. Nach Turgenev bestand Insarovs ganze Kraft darin, daß er nie seine Entschlüsse widerrief.
Brief, Bd. 11 (1875–1876), 1966, S. 491.
In der neuen Ausgabe nicht enthalten.
Vgl. dazu H. Lausberg,Handbuch der literarischen Rhetorik, 2 Bde., München 1960, Registerband unter den angegebenen Stichworten.
Palmerston “sprach ziemlich langsam, gleichsam stockend, suchte nach Worten und füllte die Zwischenpausen, indem er den Buchstabenah...ah wiederholt aussprach und in die Länge zog, half sich durch Bewegungen des rechten Armes und fand immer einen schönen und treffenden Satzschluß. ”Dieses Vorgehen gibt der Rede der Engländer “eine gewisse Natürlichkeit, etwas Gutmütiges und Unvorbereitetes und nimmt ihr jeden Anflug von Phrasenhaftigkeit”. Besser läßt sich kaum beschreiben, was die antike Rhetorik unter dem “Ethos” des Redners und der “Glaubwürdigkeit” der Rede verstand.
Vgl. 4, 33; 12, 35 “Säulen und griechische Giebel”.
Eine deutsche Übersetzung von Waldemar Grossman aus dem Dänischen von thor Lange, am russischen Original (Vestnik Evropy 1880, Nr. 4, S. 767–771) überprüft von Max Vasmer, wurde herausgegeben von Theodor Wiegand “Ivan Turgenev und die Skulpturen des Altars von Pergamon”,Zeitschrift für slavische Philologie 9 (1932), S. 70–77. Eine englische Übersetzung des Artikels unter dem Titel “Pergamon Excavations: A Letter to the Editor ofEuropean Herald” ist erschienen in: Ivan Turgenev,Literary Reminiscences and Autobiographical Fragments, übersetzt v. David Magarshack, New York 1958, S. 287–292. Zum kulturellen Kontext von Turgenevs Reaktion vgl. Suzanne L. Marchand,Down From Olympus. Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750–1970, Princeton 1996, S. 99. (Frendliche Hinweise von Wolfgang Haase).
Die subtilen Beobachtungen von J. T. Costlow (Worlds within Worlds. The Novels of Ivan Turgenew, Princeton 1960, bes. S. 110f.; 134 f. jeweils mit den zugehörigen Anmerkungen) zur Problematik der Beziehungen zur ovidischen Metamorphosendichtung und zur Hirtenpoesie werden in dem vorliegenden Aufsatz durch die Besprechung von Parallelen mit epischer Dichtung ergänzt, die bei der Diskussion von Gattungsfragen stärker berücksichtigt werden sollten als bisher üblich.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
About this article
Cite this article
von Albrecht, M. Turgenev und die Antike. Antike Reminiszenzen als Mittel der Charakterisierungskunst. Int class trad 5, 47–65 (1998). https://doi.org/10.1007/BF02701311
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02701311