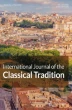References
Jene römische Form des Ehrverlustes und der Ehrverteidigung behandelt Yan Thomas, “Se venger au Forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome”, in: Raymond Verdier/Jean-Pierre Poly (Hrsg.),La Vengeance. Etudes d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Band III:Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’antiquité, Paris 1984, 65–100.
Den Unterschied hat Erich Bethe,Ahnenbild und Familiengeschichte bei Römern und Griechen, München 1935, 38–101 deutlich herausgestellt.
Die politische Funktion des Aeneas-Mythos ist ausführlich unter religiösen und rituellen Aspekten erörtert von: C. Saulnier, “Laurens Lavinas. Quelques remarques à propos d’un sacerdoce équestre à Rome”, in:Latomus 43 (1984) 517–533; A. Dubourdieu,Les origines et le développement du culte des Penates à Rome (Collection de l’ Ecole Française de Rome 118), Rome 1989, 335–361; Y. Thomas, “L’ institution de l’ origine. Sacra principiorum populi Romani”, in: M. Detienne (Hrsg.),Traces de fondation (Bibliothèque de l’ Ecole des Hautes Etudes, Sciences religieuses 93), Löwen/Paris 1990, 143–170; J. Scheid, “Cultes, mythes et politique au début de l’ Empire”, in: F. Graf (Hrsg.),Mythos in mythenloser Gesellschaft. Das Paradigma Roms (Colloquium Rauricum 3), Stuttgart-Leipzig 1993, 120.
In der klassischen Polis gab es kein vergleichbares Ritual; die politische Durchorganisierung des Raumes und der Selbstdarstellung bei den Griechen setzte einer solchen Überhöhung des individuellen Erfolges in politicis allzuenge Grenzen. Sollte hier ein ideologisch aufgeladener Begriff von ‘Individualisierung’ der Autorin die Feder führen, dann stehen Vorannahmen auf dem Spiele, die sowohl auf Unwissen wie auch letzlich auf Vorurteilen beruhen, und die sich um einen Begriff anlagern, gegen den einiges vorzubringen ist. Denn die römische Kultur erlaubte in vieler Hinsicht eine höhere ‘Individualisierung’ als die griechische: Die Kampfweise römischer Soldaten stellte—aus technischen Gründen—viel höhere Ansprüche an die individuellen Fähigkeiten als die hellenische und hellenistische Phalanx; und die rituellen und dinglichen Repräsentationsmöglichkeiten römischer Senatoren waren auf die Herausstellung individueller ‘Leistung’ direkt angelegt, und zwar nicht erst seit dem 2. Jhdt., sondern spätestens seit der Herausbildung der Nobilität, womöglich sogar noch früher. Man halte nur die Kollektivierung des Totenlobs im klassischen Athen dagegen und die politische Unmöglichkeit, Siege und Siegesruhm symbolisch der Polis zu entziehen und einzelnen zuzusprechen.
Jochen Martin, “La famiglia come cornice per i rapporti tra i sessi”, in: M. Bettini (Hrsg.),Maschile/Femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche, Bari 1993, 75–99; Yan Thomas, “A Rome, pères citoyens et cité des pères (IIe siècle avant J.-C.-IIe siècle après J.-C.)”, in: A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Segalen und F. Zonabend (Hrsg.),Histoire de la famille, I.Mondes lointains, mondes anciens, Paris 1986, 195–230 (=Ders., Yan Thomas, “Väter als Bürger in einer Stadt der Väter”, in: A. Burguière u. a. [Hrsg.],Geschichte der Familie, I:Altertum, übers. v. G. Seib, Frankfurt 1996, 277–326=Ders., Yan Thomas, “Fathers as Citizens of Rome, Rome as a City of Fathers (Second Century BC-Second Century AD)”, in: A. Burguière u.a. [Hrsg.],A History of the Family, I.Distant Worlds, Ancient Worlds, übers. von S. Hanbury Tenison u.a., Cambridge, UK/Cambridge, MA 1996, 228–269); Ders. Yan Thomas, “Remarques sur la juridiction domestique à Rome”, in: J. Andreau und H. Bruhns (Hrsg.),Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rom 1990, S. 449–474.
Ö. Oskander, “Senators and Equites V. Ancestral pride and genealogical studies in late Republican Rome”,Opuscula Romana 19 (1993) 77–90.
Dazu den ersten Teil des Werkes von Jan Assmann,Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen (ser. C.H. Beck Kulturwissenschaft), München 1992, 15–160.
Siehe dazu nun: Egon Flaig, “Diepompa funebris. Adlige Konkurrenz und annalistische Erinnerung in der Römischen Republik”, in: Otto Gerhard Oexle (Hrsg.),Memoria als Kultur (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121), Göttingen 1995, 115–148.
Thomas, “Se venger au Forum” (wie Anm. 1). Solidarité familiale et procès criminel à Rome”, in: Raymond Verdier/Jean-Pierre Poly (Hrsg.),La Vengeance. Etudes d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Band III:Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’ antiquité, Paris 1984.
So nennt F. das Leichenbegängnis ein “symbolic drama” für die römische Bürgerschaft (279). Doch dieses ‘drama’ dann sofort einen “commentary on society” zu nennen, verleitet dazu, es als einen fixierten Text zu nehmen, es seiner strategischen Valenzen zu berauben und damit seine Dynamik zu verkennen. Dagegen: V.W. Turner,Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt 1984, 94–158 (=Ders.,The Ritual Process. Structure and Anti-Structure [The Lewis Henry Morgan Lectures, 1966], Chicago 1969, 94–165); Marshall Sahlins,Inseln der Geschichte, Hamburg 1992, 40–45 (‘Performative Strukturen’) u. 133–153 (‘Struktur und Geschichte’) (=Ders.,Islands of History, Chicago 1985, 26–31 [‘Performative Structures’] und 136–156 [‘Structure and History’]); P. Bourdieu,Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt 1987, 57–96 (1. Buch, Kap. 1 und 2) u. 147–179 (1. Buch, Kap. 5) (=Ders.,Le sens pratique, Paris 1980, 51–86 bzw. 135–65).
M. Bettini,Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’ anima, Rom 1986, Kapitel 6.
F. Dupont, “Les morts et la mémoire: le masque funèbre”, in: F. Hinard (Hrsg.),La mort, les morts et l’ au-delà dans le monde Romain. Actes du colloque de Caen, 20–22 novembre 1985, Caen 1987, S. 167–172.
Diese Bemerkung habe ich in meinem Aufsatz von 1995 (ob. Anm. 8) Siehe dazu nun: Egon Flaig, “Diepompa funebris. Adlige Konkurrenz und annalistische Erinnerung in der Römischen Republik”, in: Otto Gerhard Oexle (Hrsg.),Memoria als Kultur (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121), Göttingen nicht so interpretiert wie F., sondern angenommen, daß die iulische Vorfahren-Reihe beim Leichenzug des Drusus gefehlt habe. F.s Interpretation ist jedoch möglich. Wenn freilich erst im 2. Jhdt. n. Chr. Aeneas als ‘origo Iuliae gentis’ in einem nicht-poetischen Text bezeichnet wird, so heißt das: Erst in der iulisch-claudischen Epoche hat diese Version einen offiziellen Rang erreichen können, und zwar nicht nur weil die kaiserliche Familie die Machtmittel hatte, um sie durchzusetzen, sondern weil es für große Teile der nichtaristokratischen Römer kein politisches Problem darstellte, daß die kaiserliche Familie auch gleichzeitig diejenige war, die vom ersten Gründungsheros Roms direkt abstammte. Nach dem Sturz Neros konnten auch aristokratische Familien dergens Iulia dieses Privileg überlassen, zum einen weil sie nicht mehr existierte und keine Ansprüche mehr stellen konnte, zum anderen, weil derlei Ansprüche politisch bedeutungslos waren und blieben: weder verhalfen sie Usurpatoren zur Herrschaft, noch schützten sie Kaiser davor, zu stürzen. Die gesamtrömische Funktion der Aeneas-Figur als Heros des nicht-italischen Teils der römischen Bürgerschaft dominierte immer ungefährdet.
Siehe dazu C. M. Kraay, “The coinage of Vindex and Galba A.D. 68 re-examined”, in:Numismatic Chronicle 12 (1952), 78ff, sowie P.H. Martin,Die anonymen Münzen des Jahres 68, Mainz 1974, S. 48–60. F. verweist auf A. Wallace-Hadrill, “Image and Authority in the Coinage of Augustus,”Journal of Roman Studies 76 (1986), 70. Doch der behandelt nicht die Usurpationen 68/69, hat sich mit den Studien von Kraay und Martin nicht auseinandergesetzt und reproduziert daher eine längst überholte Ansicht.
Der Autorin fehlen zu dieser Epoche die nötigen historischen Kenntnisse. Siehe dazu Egon Flaig,Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im römischen Reich (Historische Studien 7), Frankfurt/New York 1992, S. 240–416.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Flaig, E. Kulturgeschichte ohne historische Anthropologie. Was römische Ahnenmasken verbergen. Int class trad 7, 226–244 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02691398
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02691398