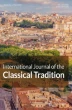Abstract
To recall the shaping of “antiquity” as a leading symbolic concept of European culture seems to be justified by the actual debate about the fault lines between modernity and postmodernity and emerging cultural fundamentalisms. In 17th century France the “Querelle des Anciens et des Modernes” fostered not only the consciousness of historical distance between now and then but brought forth the image of an enhanced antiquity, a “new Rome”. The resulting hegemony of the “esprit classique” in central Europe provoked the opposition of intellectuals in 18th century Germany searching for national cultural identity. In the dramatic course of this search for self-constitution Greek antiquity was elaborated as a symbolic token (“reine Griechheit”) for a cultural pattern that was deemed to overthrow and even transcend universally the impact of French culture. The construction of antiquity as a cognitive image (Denkbild) with aesthetic features can be considered as a response to the question if the antagonistic structure of modern life could be overcome by a utopian idea restricted, however, to a relativistic, i.e. national concept of classical studies.
Similar content being viewed by others
|o
Zu Entstehung und Bedeutungswandel der Leitbegriffe vgl. die Artikel “Antike” in:Historisches Wörterbuch der Philosophie, ed. J. Ritter, Bd. 1, Darmstadt 1971, 385–392, und “Modern, Modernität, Moderne,” in:Geschichtliche Grundbegriffe, ed. O. Brunner et al., Bd. 4, Stuttgart 1978, 93–131. S. auch Jacques Le Goff:Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt/New York 1992, 49–82.
Für viele Autoren des 18.Jh.—etwa für Thomas Blackwell und Joh. Gottfried Herder—war die historiographische Kindheitsallegorie positiv besetzt; sie diente dazu, die erwünschteÄhnlichkeit zwischen Altem (Kind) und Neuem (Mann) zu begründen, und ist symptomatisch für die genetische Strukturformel des europäischen Philhellenismus. Vgl. auch Norbert Miller: “Europäischer Philhellenismus zwischen Winckelmann und Byron”. In:Propyläen Geschichte der Literatur, 4. Bd.:Aufklärung und Romantik 1700–1830, Berlin 1983, 315ff. Noch Marx, der sein Antike-Verständnis zugleich an Winckelmann und den Junghegelianern geschult hat, macht vom Kindheitsbild Gebrauch, um die ihm merkwürdige, anscheinend a-historische Geltung des klassischen Ideals zu umschreiben. Dazu Panajotis Kondylis:Marx und die griechische Antike, Heidelberg 1987, 64ff.
Eckhard Kessler:Petrarca und die Geschichte. Geschichtsschreibung, Rhetorik, Philosophie im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, München 1978.
Hinweise und Anregungen verdanke ich den Arbeiten von Hans Robert Jauss, insbes. dem Aufsatz “Literarische Tradition und gegenwärtiges Bewußtsein der Modernität”, in: Ders.,Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt/M.31973, 11–66.
Vgl. etwa die von S. Rokkan herausgegebenen Beiträge in:Comparative Research across Cultures and Nations, Paris 1968.
Siehe die kritischen Analysen von Zygmunt Bauman:Intimations of Postmodernity, London 1992.
Franco Volpi: “Praktische Klugheit im Nihilismus der Technik: Hermeneutik, Praktische Philosophie, Neoaristotelismus”, in:Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (1992), 5–23.
Daß sich daraus eine neue Qualität globaler Zivilisationskonflikte ergeben könnte, vermutet Samuel P. Huntington: “The Clash of Civilizations?”, in:Foreign Affairs 72/3 (1993), 22–49.
Shmuel N. Eisenstadt:Tradition, Change, and Modernity, New York/Sydney/Toronto 1973. Richard Münch:Die Kultur der Moderne, 2 Bde., Frankfurt/M. 1986.
Christoph Cellarius:Historia Universalis [...] in antiquam et medii aevi ac novam divisa, 1685–1696. Vgl. dazu Ulrich Muhlack:Geschichtswissenschaft im Humanismus und in der Aufklärung. Die Vorgeschichte des Historismus, München 1991, 122f.
Vgl. dazu die systematische, auf den Wandel der Hochkulturen bezogene Skizze von S.N. Eisenstadt: “Die Mitwirkung der Intellektuellen an der Konstruktion lebensweltlicher und transzendenter Ordnungen”, in: A. Assmann/D. Harth (Hg.):Kultur als Lebenswelt und Monument, Frankfurt/M. 1991, 123–132.
Zur ethnozentrischen, also relativistischen Bedeutung des mit dem französischen “esprit classique” verbundenen Universalismus vgl. Tzvetan Todorov:Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris 1989, 19ff. Zur Geschichte des “esprit classique” nach wie vor unentbehrlich die Untersuchung von René Bray:La formation de la doctrine classique, Paris 1926.
Thomas Corneille:Le dictionnaire des arts et des sciences, Tome I, Paris 1694. Eine ähnliche Bedeutung hat “ancien” imDictionnaire de l'Académie Française (T.I., Paris 1695, 24), während “antique” hier als Bezeichnung für “sehr alt” in Opposition zu “moderne” steht.
“Il ne faut qu'avoir patience; et par une longue suite de siècles, nous deviendrons les contemporains des Grecs et des Latins.” F. Fénelon:Digressions sur les anciens e les modernes (1688). Zitat nach W. Krauss/H. Kortüm (Hg.):Antike und Moderne in der Literaturdiskussion des 18. Jahrhunderts, Berlin 1966, 67.
Vgl. zu den Ambiguitäten des Revolutionsbegriffs meinen Beitrag “Revolution und Mythos. Sieben Thesen zur Genesis und Geltung zweier Grundbegriffe historischen Denkens”, in: D. Harth/J. Assmann (Hg.):Revolution und Mythos, Frankfurt/M. 1992, 9–35.
In diesem Kontext ist die Entscheidung der Modernisten für die zeitgenössischen Pionierleistungen der Technik und Naturwissenschaften bezeichnend. Diese entzogen sich nicht nur dem Vergleich mit den klassischen Idealen, sondern verweigerten sich auch—siehe das Beispiel der Schraube—dem Modell der Naturnachahmung. Damit konnte der Kampf gegen das alte Weltbild sich auf eine Ebene zurückziehen, die in ähnlicher Weise von Traditionsbeständen frei schien wie dietabula rasa der cartesischen Vernunft. Zum ideengeschichtlichen Hintergrund vgl. Hans Blumenberg: “‘Nachahmung der Natur’. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen”, in: Ders.:Wirklichkeiten, in denen wir leben, Stuttgart 1986, 55–103.
Zur Ablösung desmagistra-Topos durch die historische Zeiterfahrung der Moderne vgl. Reinhart Koselleck:Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichticher Zeiten, Frankfurt/M. 1979, 38ff.
Joh. Martin Chladenius:Allgemeine Geschichtswissenschaft, Leipzig 1752, 100.
R. Blackmore:Essay upon Epick Poetry (1716); Jean Terrasson:Dissertation critique sur l'Iliade (1715); beide zit. nach A. Owen Aldridge: “Ancients and Moderns in the Eighteenth Century”, in:Dictionary of the History of Ideas, ed. P.P. Wiener, Bd. 1, New York 1973, 77.
Charles Perrault, der Wortführer der Modernen in derQuerelle, hat ausdrücklich die methodische Konstruktion der Maschine als Fortschrittszeichen dem Prinzip der Naturnachahmung entgegengesetzt. Vgl. dazu Hans Robert Jauss: “Ästhetische Normen und geschichtli-che Reflexion in der ‘Querelle des Anciens et des Modernes’”, Einleitung zur Neuausgabe von PerraultsParallèle des Anciens et des Modernes [1688–97], (Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences, mit einer einleitenden Abhandlung von H.R. Jauss und kunstgeschichtlichen Exkursen von M. Imdahl, Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste. Texte und Abhandlungen, 2), München 1964, 49.
Vgl. Ernst Cassirer:Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen31973, 269ff.
G.W.F. Hegel:Die Vernunft in der Geschichte, hg. von J. Hoffmeister, Hamburg51970, 4.
Encyclopédie, T. X, Paris 1765, 601.
Johann Adolf Schlegel: “Abhandlungen”, in: Charles Batteux:Einschränkung der schönen Künste auf Einen einzigen Grundsatz, Leipzig21759, 253.
S. zu dieser Art der Modernisierung des Alten Luc Ferry:Der Mensch als Ästhet. Die Erfindung des Geschmacks im Zeitalter der Demokratie, Stuttgart 1992, 54 ff.
Vgl. zu diesem gelehrten Aneignungsprozeß Arnaldo Momigliano:Wege in die Alte Welt, Berlin 1991. Über die Vorbereitung der ästhetisierenden Kunstbetrachtung durch die gelehrte Archäologie: Luigi Beschi: “La scoperta dell'arte greca”, in: S.settis:Memoria dell'antico nell'arte italina, III, Torino 1986, 293–372.
Zitat nach Aldridge [Anm. 19], 78.
Vgl. dazu Jochen Schmidt:Die Geschichte des Genie-Gedankens 1750–1945. I: Von der Aufklärung bis zum Idealismus, Darmstadt 1985, 27 u.ö.
Zu den philologiehistorischen Grundzügen dieser Entwicklung vgl. Rudolf Pfeiffer:History of Classical Scholarship from 1300 to 1850, Oxford 1976, 183ff. (Id.,Die Klassische Philologie von Petrarca bis Mommsen, München 1982, 207ff.)
Voltaire:Le siècle de Louis XIV, I, Paris 1966, 35.
Vgl. Francis Haskell & Nicholas Penny:Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500–1900, New Haven/London 1981, 36ff.
Voltaire [Anm.30], 36.
Zu Winckelmanns Kenntnis französischer Quellen s. Martin Fontius:Winckelmann und die französische Aufklärung, Berlin 1968.
Das Interesse der französischen Intellektuellen für die griechische Antike war vor allem politisch und rhetorisch motiviert; vgl. R.Zuber: “France 1640–1790”, in: K.J. Dover (Hg.):Perceptions of the Ancient Greeks, Oxford 1992, 147–169.
Vgl. Peter K. Kapitza:Ein bürgerlicher Krieg in der gelehrten Welt. Zur Geschichte der Querelle des Anciens et des Modernes in Deutschland, München 1981.
Vgl. die entsprechenden Kapitel in meinem BuchG.E. Lessing oder die Paradoxien der Selbsterkenntnis, München 1993.
Vgl. Orietta Rossi Pinelli: “Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici”, in: Settis [Anm. 26], 181–250.
Zur neueren Geschichte der Homer-Kritik vgl. Glenn Most: “The Second Homeric Renaissance. Allegories and Genius in Early Modern Poetics”, in: P. Murray:Genius. The History of an Idea, Oxford 1989, 54–75.
Goethe:Berliner Ausgabe, XIX, Berlin 1973, 378. J. W. Goethe:Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, XXII, Zürich 1949, 566. Zur zeitkritischen, die modernen ‘Anfechtungen’ aushaltenden Funktion dieses Denkens vgl. Bernhard Buschendorf:Goethes mythische Denkform. Zur Ikonographie der “Wahlverwandtschaften” Frankfurt/M. 1986, 29ff.
Vgl. z.B. Herders frühe “Fragmente einer Abhandlung über die Ode” [1765]. in:Sämmtliche Werke, hg. von B. Suphan XXXII, Berlin 1899, 61–85. Karl Phillip Moritz beginnt seineGötterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten von 1791 mit dem Satz: “Die mythologischen Dichtungen müssen als eine Sprache der Phantasie betrachtet werden.”, in Ders.:Schriften zur Ästhetik und Poetik, ed. H.J. Schrimpf, Tübingen 1962, 195.
Alexander Gottlieb Baumgarten:Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der “Aesthetica” (1750/58), übers. u. hg. von H.R. Schweizer, Hamburg 1983, Einleitung des Hg., p. XIII.
Johann Joachim Winckelmann:Geschichte der Kunst des Altertums [1764], Darmstadt 1982, 152.
J.J. Winckelmann:Ausgewählte Schriften und Briefe, hg. von W. Rehm, Wiesbaden 1948, 9.
Vgl. Tonio Hölscher: “Tradition und Geschichte. Zwei Typen der Vergangenheit am Beispiel der griechischen Kunst”, in: J. Assmann/T. Hölscher (Hg.):Kultur und Gedächtnis, Frnakfurt/M. 1988, 115–149. Zur dialektischen, die Spannung zwischen Starre und Bewegung aushaltenden Tendenz in Winckelmanns Ästhetik vgl. Peter szondi:Poetik und Geschichtsphilosophie I: Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit. Hegels Lehre von der Dichtung, Hg. von S. Metz/H.-H. Hildebrandt, Frankfurt/M. 1974, 43ff.
In derAllgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, von Ersch & Gruber (4. Theil, 1820, 300 ff.) schreibt Bouterwek, erst das Studium des “antiken im ästhetischen und artistischen Sinne” habe “das Moderne” hervorgebracht. Noch imDeutschen Wörterbuch der Brüder Grimm von 1854 (Bd.1, 500) finden sich unter dem Lemma “Antike” nur die aufs Kunstwerk verweisenden Primär-Erläuterungen: “opus antiquum, artis opus”.
Vgl. meinen Essay “Zerrissenheit. Der deutsche Idealismus und die Suche nach kultureller Identität”, in: Assmann/Hölscher [Anm.44], 220–240.
Ausgewählte Schriften [Anm. 43], 13f.
a.a.O.Ausgewählte Schriften [Anm. 43], 124.
Die intendierte semantische Ähnlichkeit zwischen dem Ganzen einer Kulturnation, eines ästhetischen Werkes und universeller Menschheitsrepräsentanz faßt, soweit hier Präzision überhaupt möglich, am genauesten Wilhelm von Humboldt in seinen verschidenen Studien über die identitätsbildende Funktion der klassischen Bildung:Schriften zur altertumskunde und Ästhetik, Werke II, Hg. von A. Flitner K. Giel, Darmstadt 1961.
Moritz [Anm.40], 106f. Vgl. auch die Nr. 6 von SchillersBriefen über die ästhetische Erziehung des Menschen.
F. Schiller,Sämtliche Werke, Säkular-Ausgabe, Stuttgart/Berlin [o.J.], XII, 22, 228; XVI, 227. Zu schillers ethnozentrischer Relativierung des französischen Klassizismus vgl. u. a. seine Gedichte “An Goethe” (1800) und “Die Antiken zu Paris” (1803).
F. Schlegel:Schriften zur Literatur, hg. von W. Rasch, München 1972, 156.
Schlegel a.a.O.,Schriften zur Literatur, hg. von W. Rasch, München 1972, 178. Zu Schlegels “ästhetischer Hermeneutik” vgl. Heinz-Dieter Weber:Friedrich Schlegels “Transcendentalpoeesie”. Untersuchungen zum Funktionswandel der Literaturkritik im 18. Jh., München 1973, 156f.
Schlegel a.a.O.,Schriften zur Literatur, Hg. von W. Rasch, München 1972, 190.
Vgl. J. Wohlleben: “Germany 1750–1830”, in: Dover [Anm. 34], 175ff. Zur Konjunktur der philologisch-historischen Antikeforschung in Deutschland vgl. A. Grafton: “Germany and the Wet 1830–1900”, in: Dover [Anm. 34], 225ff.; A. Horstmann:Antike Theoria und moderne Wissenschaft. August Boeckhs Konzeption der Philologie, Philologie und Geschichte der Wissenschaften. Studien und quellen, 17, Frankfurt/M., Berlin etc. 1992.
Wie viele seiner Zeitgenossen weist Schlegel selber auf die kulturrelativistische Geltung des Universalismus hin: “Sollte der jetzige französische Nationalcharakter nicht eigentlich mit dem Karkinal Richelieu anfangen? Seine seltsame und beinah abgeschmackte Universalität erinnert an viele der merkwürdigsten französischen Phänomene nach ihm” (a.a.O.,Schriften zur Literatur, hg. von W. Rasch, München 1972, 77).
Author information
Authors and Affiliations
Additional information
Nach einem Vortrag gehalten auf der 2. Tagung der International Society for the Classical Tradition, Tübingen, 13.–16. August 1992.
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Harth, D. Über die Geburt der Antike aus dem Geist der Moderne. International Journal of the Classical Tradition 1, 89–106 (1994). https://doi.org/10.1007/BF02679082
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02679082