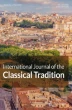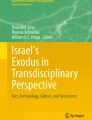Abstract
In the prologue of the so-calledHalberstadt Kaland Book—the Kalands being a kind of religious community, especially in the northern part of Germany—a doctrine of friendship is briefly presented. Written in the 13th century, the prologue consists of several sayings ascribed to different authors combined by connecting phrases. So it can be called atractatus. The doctrine of friendship expressed in it is here interpreted for the first time, and its sources (Old Testament, Cicero, Seneca, Augustinus, Isidorus) are identified. The prologue reveals essential features of medieval ideas of perfect friendship and therefore claims a place, although a modest one, in the history of medieval ethical thought.
Similar content being viewed by others
References
Aelred von Rieval,Über die geistliche Freundschaft. Lat.-deutsch. Ins Deutsche übertragen von Rhaban Haacke, eingeleitet von Wilhelm Nyssen, Trier 1978.
Petrus von Blois,De amicitia christiana et de charitate Dei et proximi, MignePL 207, col. 871–958; Marie Magdeleine Davy,Un traité de l'amour du XIIe siècle: Pierre de Blois, Paris 1932.
Anette Erler,Der Halberstädter Karls-oder Philosophenteppich, Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris 1989 (Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters 25).
Halberstadt, im Norden Deutschlands gelegen, spielte im Mittelalter im politischen wie auch im geistig-kulturellen Leben Deutschlands eine nicht unbedeutende Rolle. Davon zeugt nicht zuletzt noch heute der das Stadtbild beherrschende Dom mit seiner reichen Innenausstattung und seinem kostbaren Domschatz, in dem die ältesten erhaltenen Wirkteppiche des europäischen Mittelalters aufbewahrt werden. S. bes. Johanna Flemming/Edgar Lehmann/Ernst Schubert,Dom und Domschatz zu Halberstadt, Berlin 1973 und Wien/Köln 1974 (Berlin2 1976).
Franz Winter, “Statuten und Mitgliederverzeichnisse der Halberstädter Calandsbruderschaft,”Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde 1, 1868, S. 55–63; s. Anhang I.
Noch im 13. Jahrhundert verfaßt der Priester Koenemann (gest. 1316) aus Dingelstedt am Harz eine längere Versdichtung über den Kaland in deutscher Sprache, die bis Mitte des 17. Jahrhunderts im nördlichen Harzgebiet bekannt war. Neben anderen Quellen benutzt er dafür auch das Halberstädter Kalandsbuch. S. Ludwig Wolff,Die Dichtungen Koenemanns. Kaland. Wurzgarten. Reimbibel, Neumünster 1953, S. 1f.; 13 f. (Niederdeutsche Denkmäler 8). Man nimmt daher an, daß das Kalandsbuch spätestens im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Eine frühere Abfassung hält Moritz Riemer für nicht ganz ausgeschlossen: “Die Entstehung der Kalande im Bistum Halberstadt,”Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde 41, 1908, S. 15, Anm. 15. Auch einige seiner vielen lateinischen Zitate übernimmt Koenemann aus dem Halberstädter Prolog. Das wird besonders im 3. Buch deutlich: hier wie dort werden Seneca- und Cicero-Zitat falsch zugeordnet. S. Wolff, a.O., S. 74, S. 76.
Cod. Guelf. 227 Extrav., fol. 78r–90v.
Am bekanntesten ist dasSpeculum majus des Vinzenz von Beauvais aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, Augsgabe Douai 1624.
s. oben Anm. 5.
Literaturauswahl: M. Riemer, s. oben Anm. 6; Carl Brod, “Die Kalandsbruderschaften in den sächsisch-thüringischen Landen”Neues Archiv für Sächsische Geschichte 62, 1941, S. 1–26; L. Wolff, s. oben Anm. 6; Günther Hauke, “Die Kalandsbruderschaft Holmstedt-Nordheim,”Nordheimer Neueste Nachrichten, 1964, Nr. 33; Franz Flaskamp, Art. “Kalandsbruderschaften,”Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 5, Freiburg/Br2. 1960, S. 1255 (Sonderausgabe Freiburg/Br. 1986).– Im Jahr 1780 gehörten zur Halberstädter Kalandsgemeinde noch 6 Mitglieder. S.Der Bürger. Eine Wochenschrift, 2. Jg., 17. Stück, Halberstadt 1780.
z.B. bei Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153); s. Etienne Gilson,La Théologie mystique de Saint Bernard, Paris 1934, bes. S. 20–25.
Zu Aelred von Rievaulx s. Richard Egenter,Gottesfreundschaft, Augsburg 1928, S. 201–245; Georg Misch,Geschichte der Autobiographie, Bd. 3, 1. Hälfte, Frankfurt a.M., 1959, S. 464–504; zu Petrus von Blois s. R. Egenter, a.O., Richard Egenter,Gottesfreundschaft, Augsburg 1928, S. 243–245.
z.B. finden sich imPolycraticus des Johannes von Salisbury (um 1115–1180), einer Lehre von der Staatenlenkung, an nicht wenigen Stellen Aussagen über Freundschaft: l. III, c. 5; 7; 12 u.ö.:Opera omnia, ed. John Allen Giles, Oxonii 1848 (Neudr. Leipzig 1969).
August Nitschke, Art. “Freundschaft,”Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Basel/Stuttgart 1972, Sp. 1105–1108; Heinz-Horst Schrey, Art. “Freundschaft,”Theologische Realenzyklopädie, Bd. 11, Berlin/New York 1982, S. 590–599; Wilhelm Geerlings, Art. “Freundschaft,”Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, München/Zürich 1987/89, Sp. 911–912.
Karl August Neuhausen schreibt 1975: “Eine Darstellung der Wirkungsgeschichte von Ciceros Laelius steht freilich noch aus”: “Zu Cassians Traktat de amicitia (coll. 16),” in:Studien zur Literatur der Spätantike, hrg. von Christian Gnilka und Willy Schetter, Bonn 1975, S. 186, Anm. 29 (Antiquitas. Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte 23). Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ob Neuhausen selbst einmal die Lücke füllen wird, bleibt abzuwarten. Von seinem Kommentar zumLaelius sind erst die Lieferungen I–III, Heidelberg, 1981–1992, erschienen. Einzelne Bemerkungen zurLaelius-Rezeption finden sich an verschiedenen Stellen, z.B. bei E. Gilson, a.O.,La Théologie mystique de Saint Bernard, Paris 1934, bes. S. 20–24; R. Egenter, a.O.,Gottesfreundschaft, Augusburg 1928, S. 93–95; 233–237. Mehr Aufschluß bieten die zahlreichen Hinweise bei Max Manitius,Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München 1911/31; Neudr. 1965/73: Bd, I, S. 479–481; II, S. 50; 62; 64 f.; III S. 146 f. (Aelred); 282; 317. Informativ sind auch die Angaben von Walter Rüegg, Art. “Cicero im Mittelalter und Humanismus,”Lexikon des Mittelalters, Bd. 2, München/Zürich 1981/83, Sp. 2063–2072. Er weist besonders auf die steigende Beliebtheit desLaelius seit dem 11. Jahrhundert, genauer seit dem Verbot der Eheschließung für Kleriker durch Gregor VII. i.J. 1074, hin. Nur beiläufig berührt dagegen Michael von Albrecht in seinerGeschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boethius, die auch Fragen des Nachwirkens ausdrücklich einbezieht, dieLaelius-Rezeption im Mittelalter: Bd. I, Berlin 1992, S. 444.
Brian Patrick McGuire,Friendship and Community. The Monastic Experience 350–1250, Kalamazoo, Michigan 1988 (Cistercian Studies Series 95).
Reginald Hyatte,The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval and Early Renaissance Literature, Leiden/New York/Köln 1994 (Brill's Studies in Intellectual History 50).
Rez. Timothy Reuter,Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 47, 1991, S. 697 f.
S. IX: “three categories of ideal friendship-Christian, chivalric, and humanistic.”
s. mein oben Anm. 3 zitiertes Buch, S. 119–131.
Kurt Treu, Art. “Freundschaft,”Reallexikon für Antike und Christentum, Bd, 8, Stuttgart 1969/72, Sp. 418–434.
Saint Ambroise,Les devoirs, livers I–III, texte établi, traduit et annoté par Maurice Testard, Paris 1992.—Seine Freundschaftslehre ist im letzten Kapitel des 3. Buches enthalten.
Manitius III, S. 966: “Ciceros Schrift de amicitia [wurde], anscheined öfter gelesen als alle übrigen Werke des vielbewunderten Römers.” G. Misch, a.O.Geschichte der Autobiographie, Bd. 3, 1. Hälfte, Frankfurt a.M., 1959, S. 470: “Ciceros Laelius gehörte damals [12. Jh.] zu den viel gelesenen Büchern.”—Welche Bedeutung demLaelius im Mittelalter zugesprochen wird, zeigen die vielen Belegstellen, die ihn namentlich—also nicht nur anonyme Zitate aus ihm, sondern Zitate mit Nennung des Autors und/oder des Titels—anführen. Zwei Belege dafür: Wibald von Stablo (1097/99-1158):illa Tulliani dialogi sententia de amicitia: Bibl. rer. Germ. T. I, Berlin 1864 (Neudr. 1964),Mon. Corbeiensia, ep 56; Johannes von Salisbury,Polycraticus: Scitum est illud Laelii, aut potius Ciceronis, I. III c. 4; s. auch c. 5; 7.
Aussagen über den Umgang mit Freunden besonders im 6. Kapitel.
6, 16:amicus fidelis medicamentum vitae et inmortalitatis/qui timet Deum aeque habebit amicitiam bonam.
28:Sed hoc primum sentio, nisi in bonis amicitiam esse non posse, s. auch 65.
III 137:Ergo qui facit mandatum Dei, amicus est, hoc honoratur nomine.
Opera, ed. John Sherren Brewer, London 1861/91, Bd. I, S. 238,ep. 13.
Walter Zöllner, “Die Halberstädter Ars dictandi aus den Jahren 1193/94 nach einer Handschrift der Österr. Nationalbibliothek,”Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Gesellschafts- u. sprachwissenschaftliche Reihe 13, 1964, S. 547, Nr. 192.
In der kritischen Ausgabe desLaelius von Karl Simbeck, Leipzig 1917 (Bibl. Teubneriana 47; Neudr. Stuttgart 1976), ist zuLaelius 17 und 22 eine andere Lesart nicht verzeichnet.
z.B. schreibt Jacobus von Cessolis, Lehrer der Theologie in Reims, in seinem Traktat über das Schachspiel (um 1275):Quae (=amicitia) omnibus rebus praeponenda est (Lael. 17: anteponatis); aber:Honores, divitiae et voluptates et cetera hujus genera, quae videntur esse utilia, nunquam amicitiae anteponenda sunt (Lael. 63: anteponant): Solacium ludi scacorum sive Liber de moribus hominum, hrg. von Ernst Köpke,Mitteilungen aus den Handschriften der Ritter-Akademie zu Brandenburg/a.H., Programm 1879, Nr. 59, S. 19. Jacobus von Cessolis verwendet also beide Verben. Zwei Beispiele für das zweite Zitat: Äbtissin Eangyth an Bonifatius (672/75-754):Et ut dicitur, quid dulcius est, quam habere illum, cum quo omnia possis loquid ut tecum: Bibl. rer. Germ. T.III, Berlin 1866 (Neudr. 1964),Mon. Moguntina, ep 14; Alkuin (um 730–804):Quid dulcius est, quam habere amicum, cum quo possis omnia loqui, sicut tecum: Bibl. rer. Germ. T. VI, Berlin 1873 (Neudr. 1964),Mon. Alcuiniana, ep 224.
Mir ist das Verbum “anteponere” bei der Lektüre mittellateinischer Texte seltener begegnet als “praeponere.” Ich gebe nur einige Beispiele an, wo “praeponere” auf “amicitia” bzw. auf “amicus” bezogen ist: Petrus Venerabilis (1902/94-1156):Inter varias pectoris mei curas, ingessit se aliquando cogitatio de amicitia, et quem cui amicum vel praeponere vel supponere deberem, … invenerit in amicitia nulli supponendum, pene omnibus praeferendum: lib. epp III 12, MignePL 189, col. 317; Petrus von Blois:Teste Tullio quidem errant, qui praeferre pecuniam amicitiae sordidum aestimant. Illos autem erat impossibile reperiri, qui honores, magistratus, imperia, potestates amicitiae non praeponunt (Lael. 63: anteponant): De amicitia christiana …, a.O., col. 889.
Arnoldus Saxo:Tam audaciter cum illo (=amico) loquere quam tecum: De finibus rerum naturalium (um 1225), pars V, II 9, hrg. von Emil Stange,Kgl. Gymnasium zu Erfurt. Beilage zum Jahresbericht 1906/07, S. 110.
[Pseudo]-Seneca,Liber de moribus, ed. Eduard Woelfflin, in:Publilii Syri Sententiae, Lipsiae 1869, S. 136–148.
s. mein oben Anm. 3 zitiertes Buch, S. 165–166; 168–170.
Otto von Freising (1111/15-1158):L. Seneca, non tam philosophus quam bene christianus dicendus: Chronica sive Historia de duabus civitatibus II 40, hrg. von Walther Lammers, Berlin 1960, S. 178 (Auggewählte Quellen zur deutschen Geschichte 16).
Ambrosius III 132:Servate igitur, filii, initam cum fratribus amicitiam, qua nihil est in rebus humanis pulchrius; Petrus Cellensis (gest. 1183):In omni possessione praecellit amicorum possessio. Potest enim parari, sed comparari non potest amicus: lib. epp I 39; MignePL 202, col. 439;nihil est amicitia dulcius in rebus humanis, sed hoc fit cum hominis persona diligitur, non fortuna, ep 60, a.O., col. 488.
Gerbert von Reims (940/950–1003):Quid enim est aliud vera amicitia, nisi divinitatis praecipuum munus: Monumenta Germaniae Historica. Briefe der deutschen Kaiserzeit II, hrg. von Fritz Weigle, Weimar 1966, S. 217,ep 184; Petrus Abaelard (1079–1142):Omnia dona Dei transcendit verus amicus: Carmen ad Astrolabium filium, s. G., Misch, a.O.,Geschichte der Autobiographie, Bd. 3, 1. Hälfte, Frankfurt a.M., 1959, S. 694 u. Anm. 433; Aelred von Rievaulx III 91:quae (=amicitia) naturae simul et gratiae optimum donum est.
s. mein oben Anm. 3 zitiertes Buch, S. 83–99.
Angilbert (um 745–814), Schüler Alkuins:Sed secundum sapientes talis amicus raro invenitur et difficile servatur: Bibl. rer. Germ. T. IV, Berlin 1867 (Neudr. 1964),Mon. Carolina, ep 13; Petrus Venerabilis:O amicitia, res inter mortales admodum pretiosa, sed quanto carior, tanto rarior, quo abisti?, a.O., col. 72,lib. epp I 5.
Stephan von tournai (oder Orléans, 1128–1203),Lettres, ed. Jules Desilve, Valenciennes/ Paris 1893,ep 240.
Ambrosius III 129:Defer amico ut aequali nec te pudeat ut praevenias amicum officio; amicitia enim nescit superbiam; III 133:Pietatis custos amicitia est et aequalitatis magistra ut superior inferiori se exhibeat aequalem, inferior superiori. Inter dispares enim mores non potest esse amicitia; Aelred von Rievaulx III 91:Itaque in amicitia… sublimis descendat, humilis ascendat… et ita unusquisque alteri suam conditionem communicet ut fiat aequalitas; s. auch I 57.—Lael. 69; 71; 72.
III 70, mit Hinweis auf Ambrosius; s. auch III 131.
Sententiarum lib. III 28,2:De dilectione, MignePL 83, col. 702.
Aelred von Rievaulx I 11; 46; III 8; Petrus Venerabilis, a.O.,O amicitia, res inter mortales admodum pretiosa, sed quanto carior, tanto rarior, quo abisti? col. 268,lib. epp II 45; Arnoldus Saxo, a.O.Tam audaciter cum illo (=amico) loquere quam tecum: De finibus rerum naturalium (um 1225), pars V, II 9, hrg. von Emil Stange,Kgl. Gymnasium zu Erfurt. Beilage zum Jahresbericht 1906/07, S. 109.
De inventione II 166:amicitia est voluntas erga aliquem rerum bonarum illius ipsius causa, quem diligit, cum eius pari voluntate.—Wilhelm von Conches (um 1080–1154):amicitia est voluntas bona erga aliquem causa illius: Moralium dogma philosophorum, hrg. von John Holmberg, Uppsala 1929, S. 26; Jacobus von Cessolis:de qua dicit Tullius, quod amicitia est voluntas erga aliquem bonarum rerum illius causa, quem diligit: Solacium ludi scacorum … a.O., S. 19.
Im allgemeinen wird Isidor von Sevilla im lateinischen Mittelalter zum Thema “amicitia” weniger herangezogen. Er wird z.B. bei Aelred von Rievaulx und Petrus von Blois nicht namentlich erwähnt. Der Aufsatz von Joachim Diesner, “‘amicitia’ bei Isidor von Sevilla,” in:Forma Futuri. Studi in onere del Cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, S. 229–231, bringt nur eine kurze Darstellung von isidors Freundschaftsverständnis und geht nicht auf dessen Wirkungsgeschichte ein. Auch das Standardwerk zur Isidorforschung von Jacques Fontaine,Isidore de Séville et la culture classique dans l"Espagne visigothique, Paris 1959 (2e éd. revue et corrigée, Paris 1983), befaßt sich nicht speziell mit Freundschaft bei Isidor und deren Nachwirkung im lateinischen Mittelalter. Ebenso unergiebig für das Thema ist Charles Henry Beeson,Isidor-Studien, München 1913 (Quellen und Untersuchungen zur lat. Philologie des Mittelalters IV, 2).
Harald Hagendahl,Augustine and the Latin Classics, Bd. I, Göteborg 1967, S. 94–96 (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 20).
Hier verrät Isidor, daß ihm derLaelius nicht unbekannt gewesen sein kann. Einige seiner Formulierungen stimmen fast wörtlich mit ihm überein:Lael. 23:Quomque plurimas et maximas commoditates amicitia contineat, tum illa nimirum praestat omnibus, quod bonam spem praelucet in posterum nec debilitari animos aut cadere patitur; 22:amicitia res plurimas continet; quoquo te verteris, praesto est, nullo loco excluditur, numquam intempestiva, numquam molesta est… nam et secundas res splendidiores facit amicitia et adversas partiens communicansque leviores.
Lael. 51:non igitur utilitatem amicitia, sed utilitas amicitiam secuta est; Aelred von Rievaulx II 64:Cum igitur in bonis semper praecedat amicitia, sequatur utilitas.
Aelred von Rievaulx II 11:Vae soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se. Solus omnino est, qui sine amico est; Petrus Cellensis:Vae enim soli … Si autem fuerint duo, fovebuntur mutuo, a.O., col. 601,lib. epp II 167; Petrus Cantor (1120/30–1197):〈Vae soli〉, singulari videlicet, adinventiones, et novos usus, et modos videndi ex superbis, vel superstitiosa praesumptione invenienti, 〈quia, si ceciderit, non habet sublevantem〉: Verbum abbreviatum, MignePL 205, col. 204; Petrus von Blois:Solus est, qui sine amico est. Vere dicitur solus, quia si ceciderit, non habet sublevantem: De amicitia christiana …, a.O., col. 874.
〈aliquis vir bonus nobis diligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tamquam illo spectante vivamus et omnia tamquam illo vidente faciamus〉. Hoc, mi Lucili, Epicurus praecepit (frg. 210 Us.).
Anders imLaelius: 23:verum enim amicum qui intuetur, tamquam exemplar aliquod intuetur sui; 38:ex hoc numero nobis exempla sumenda sunt.
Wilhelm von Conches,Moralium dogma philosophorum (unter dem Begriff “reverentia”), a.O., S. 26 f.; Petrus Cantor,Verbum abbreviatum, a.O., col. 216 (in c. 72:Commendatio solitudinis loci); Arnoldus Saxo,De finibus rerum naturalium, pars V, II 4:De conversatione, a.O., S. 105.
Alkuin:Multae sunt invidiae et perfidiae hominum; plurimum sunt amici in mensa et rari in necessitate: Mon. Alcuiniana, a.O., S.873,ep 289; Hraban (780–856):Sapientia notat amicum quitantum propter epulas mensae stat, et in necessitate subtrahit se: Comment. in Ecclesiasticum II 2. MignePL 109, col. 797;quia multi amici mensae non permanebunt in die necessitatis,III, 7, a.O., col. 847.
De cons. III, pros. 5. Otto von Freising:Imperator satius existimans habere detectos inimicos quam fictos amicos, pro eo quod, ut dicitur, nulla pestis…:Gesta Frederici seu rectius Cronica IV 59, hrg. von Franz-Josef Schmale, Berlin 1965, S. 620 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte 17); Petrus von Blois:Nulla pestis efficacior est ad nocendum quam familiaris et domesticus inimicus; hic est ignis in gremio, serpens in sinu, MignePL 207, col. 34,ep 11.
Author information
Authors and Affiliations
Additional information
Nach einem Vortrag gehalten auf der 2. Tagung der International Society for the Classical Tradition (ISCT), Tübingen, 13.–16. August 1992.
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Schmidt-Erler, A. De amicitia et charitate. Fortwirkung alttestamentlicher, antiker und spätantiker Freundschaftsvorstellungen im Halberstädter Kalandsprolog. International Journal of the Classical Tradition 2, 3–26 (1995). https://doi.org/10.1007/BF02678167
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02678167