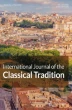Abstract
Memory and forgetting are key subjects of current historical and sociological research. Their meaning embraces passive as well as active forms of collective recollection and oblivion, activities of retention as well as of dynamic shifting in the broad field of symbolic representation. Applied toRezeptionsgeschichte andWirkungsgeschichte in the perspective of the Classical Tradition, those key terms signify the complex interplay between change and continuity. The materials discussed under this assumption mainly range from theories and practices of memory in Antiquity and the Middle Ages to Renaissance systems of architecture and art, from the early emergence of advanced civilizations to a modern conceptualized history of cultural change. The connecting element is the theoretically defined concept of “cultural memory” not only comprising textuality and literary techniques of memory but also image production and ritual activities in non-literate societies. At the end the question will be asked, whether there are any alternative ways of culture-investigation lying hidden within cultural memory itself.…nam et omnis disciplina memoria constat. Quintilian
Similar content being viewed by others
References
Vgl. z.B. folgende Sammelbände: R. Herzog, R.Koselleck (Hg.):Epochenschwelle und Ephochenbewußtsein, München 1987 (hier insbes. die Beiträge von M. Fuhrmann, R. Herzog, C. Meier); W. Voßkamp (Hg.):Normativität und Historizität europäischer Klassiken, Stuttgart/Weimar 1993; H. Flashar (Hg.):Altertumswissenschaft in den 20er Jahren. Neue Fragen und Impulse, Stuttgart 1995.
G. W. F. Hegel:Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, § 464.—Zum Funktions- und Bedeutungswandel der thematischen Konzepte vgl. die von mir hrsg. AnthologieDie Erfindung des Gedächtnisses (Frankfurt/M. 1991) und meinen Artikel “Erinnerung & Gedächtnis”, in:Handbuch Historische Anthropologie, hg.v. C. Wulf (erscheint 1996).
I. Rosenfield:The Invention of Memory. A New View of the Brain, New York 1988.
P. Rossi: “La scienza e la dimenticanza”,Iride VIII/14 (1995), S.157, zitiert u.a. Francis Bacon: “Scientia ex naturae lumine petenda, non ex antiquitatis obscuritate repetenda est. Nec refert quid factum fuerit. Illud videndum quid fieri possit.”
P. Rossi:Il passato, la memoria, l'oblio. Sei saggi di storia delle idee, Bologna 1991, S.155ff.
“Wissenschaftliches Gedächtnis” verwende ich in der Bedeutung von “kontrapräsentischer Erinnerung” nach G. Theissen: “Tradition und Entscheidung. Der Beitrag des biblischen Glaubens zum kulturellen Gedächtnis”, in:Kultur und Gedächtnis, hg. v. J. Assmann/T. Hölscher, Frankfurt/Main 1988. Theissen spricht zwar die “kontrapräsentische” Funktion dem zu, was er das “kulturelle Gedächtnis” nennt: “Kulturelles Gedächtnis hält kontrapräsentisch fest, was ohne die bewußte Anstrengung der Erinnerung verlorenginge. Das von ihm Erinnerte muß nicht aktuell sein, kann aber immer wieder aktuell werden” (S.171). Diese Beschreibung möchte ich aber nur für die Art der Gedächtnisbewahrung gelten lassen, die im Sinne des historischen Bewußtseins den Zeitenabstand zwischen Vergangenheit und Gegenwart reflektiert.
Hinweise auf die kultur- bzw. sprachwissenschaftlichen Beiträge zur ‘Erfindung’ von Nationalismen bei B. Anderson:Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1983.
Vgl. zur Geschichte dieses Deutungsmusters die Untersuchung von G. Bollenbeck:Bildung und Kultur. Glanz und elend eines deutschen Deutungsmusters, Frankfurt/Main 1994.
The past is a foreign country lautet der Titel eines Buches von David Lowenthal (Cambridge 1985).
Zur legitimatorischen Funktion kultureller Muster für die Anwendung und Aufrechterhaltung physischer und struktureller Gewalt vgl. den systematischen Aufriß von J. Galtung: “Cultural violence”,Journal of Peace Research 27/3 (1990), S.291–305, und den Beitrag von A. und J. Assman: “Kultur und Konflikt. Aspekte einer Theorie des unkommunikativen Handelns”, in: J. Assmann/D. Harth (Hg.):Kultur und Konflikt, Frankfurt/Main 1990, S11–48.
Vgl. auch den interessanten, vom Generationenabstand ausgehenden Erklärungsversuch J. Assmanns in seiner unten genannten Untersuchung (Anm. 13, S.21ff.).
“Quali interrogativi la scienza pone alla filosofia? Conversazione con Massimo Cacciari”, in: P. Alferi/A. Pilati (Hg.):Conoscenza e complessità, Rom/Neapel 1990, S.164. Zur permanenten Um-Schreibung des kulturellen Gedächtnisses in der modernen Philosophie vgl. den SammelbandPhilosophical Imagination and Cultural Memory. Appropriating Historical Traditions (hg.v. P. Cook, Durham/London 1993), dessen Titel und Einleitung hinter der nützlichen, von Theissen (Anm.6) vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen “Tradition” und “kulturellem Gedächtnis” zurückbleibt.
Im Zentrum stehen folgende Publikationen: J. Coleman:Ancient and medieval memories. Studies in the reconstruction of the past, Cambridge 1992; M. Carpo:Metodo e ordini nella teoria architettonica dei primi moderni: Alberti, Raffaello, Serlio e Camillo, Genf 1993; S. Küchler/W. Melion (Hg.):Images of memory. On remembering and representation, Washington/London 1991; J. Assmann:Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992.
Vgl. insbesondere P. Rossi:Clavis Universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Mailand/Neapel 1960.
Das gilt nicht nur für Colemans Studien, sondern auch für die Untersuchung von Mary J. Carruthers:The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge 1990.
S. meinen Forschungsartikel “Geschichtsschreibung”, in:Historisches Wörterbuch der Rhetorik, hg.v. G. Ueding, Tübingen, Bd. III (erscheint 1996).
Carruthers (Anm. 15), S.222ff.
John of Salisbury:Policraticus, hg.v. C. C. J. Webb, Oxford 1909, Prolog. Vgl. auch die (von Coleman nicht erwähnte) ausführliche Untersuchung von P. von Moos:Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die historiae im PolicraticusJohanns von Salisbury, Hildesheim 1988.
M.-D. Chenu:La Théologie comme science au XIIIème siècle, Paris 1957, SS.15ff., 37ff.
P. Ricoeur: “Le temps raconté”Revue de Métaphysique et de Morale 89/4 (1984), S.448.
S. Colemans Kritik an den Thesen Peter Burkes: op. cit., S.563ff.
Vgl. P. Kondylis:Die neuzeitliche Metaphysikkritik, Stuttgart 1990, S.45ff.
Dazu S. Settis: “Continuità, distanza, conoscenza. Tre usi dell'antico”, in: S. Settis (Hg.):Memoria dell'antico nell'arte italiana, Bd.III, Turin 1986, S.373–486.
Zur Sakralisierung eines verpflichtenden Kanons durch die Kirche s. Assmann (Anm. 13), J. Assmann:Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992. S.116ff.
Zit. nach J. B. Metz: “Erinnerung”, in:Handbuch philosophischer Grundbegriffe, hg.v. H. Krings/H.M. Baumgartner/C. Wild, Bd. 2, München 1973, S. 388. Zahlreiche Bibel-Belege für die imperativische Mnemonik der jüdisch-christlichen Glaubensdoktrin zitiert J. Le Goff: “Memoria”, in:Enciclopedia Einaudi VIII, Turin 1979, S.1081ff. Vgl. allgemein J. Le Goff:Histoire et mémoire, Paris 1986.
Zur sozialen und politischen Funktion der Gedächtniskultur im Mittelalter s. die Einzelstudien in:Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters, hg.v. D. Geuenich und O. G. Oexle, Göttingen 1994.
Zur theoretischen Grundlegung M. Foucault:L'archéologie du savoir Paris 1969. Paradoxerweise greift Foucault zur Kennzeichnung der wissenschaftlichen Gegenstandskonstitution jenseits von Text- sowie hermeneutisch erschließbaren Sinngestalten (=“document”) auf den Begriff “monument” zurück, um das Forschungsobjekt aus der konventionell unterstellten geistesgeschichtlichen Dienstleistung zu entlassen. Zu den Schwierigkeiten, mit denen diese Konzeption zu kämpfen hat, vgl. M. Frank: “Ein Grundelement der historischen Analyse: die Diskontinuität—Die Epochenwende von 1775 in Foucaults ‘Archäologie’”, in: Herzog/Koselleck (Anm. 1), S. 97–130.
Vgl. P. Burke:Tradition and Innovation in Renaissance Italy. A Sociological Approach, [o.O.] 1974, S.340.
Zur Verschiebung derars musica von der mittelalterlichen Zahlenlehre zur humanistischen Poetik, von derimitatio zumingenium, vgl. K. W. Niemöller: “Zum Paradigmenwechsel in der Musik der Renaissance. Vomnumerus sonorus zurmusica poetica”, in:Literatur, Musik und Kunst im übergang vom Mittelalter zur Neuzeit., hg.v. H. Boockmann et al., Göttingen 1995, S.187–215.
L. A. Ciapponi: “Il ‘De Architectura’ di Vitruvio nel primo Umanesimo”Italia medievale e umanistica 3 (1960), S.95ff. Vgl. L. Callebat, “La Tradition Vitruvienne au Moyen Age et à la Renaissance. Eléments d' Interprétation,”International Journal of the Classical Tradition (IJCT) 1.2 (Fall 1994), S. 3–14.
F. Zöllner:Vitruvs Proportionsfigur. Quellenkritische Studien zur Kunstliteratur des 15. und 16. Jahrhunderts, Worms 1987.
L. B. Alberti:De re aedificatoria, hg.v. M. Finoli und P. Portoghesi, Mailand 1966, Bd.II, S.441. Vgl. C. Thoenes: “Anmerkungen zur Architekturtheorie,” in:Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo, hg. v. B. Evers, München/New York 1995, S. 28–39; H.-W. Kruft:Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart, München31991, S. 47ff.
Kruft (Anm. 32), H.-W. Kruft:Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart, München31991, S. 49.
Zur Anwendung derdivisio in der scholastischen Logik und Topik vgl. M. Grabmann:Die Geschichte der scholastischen Methode, Bd. II:Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert [1911], Darmstadt 1956, S. 426ff., 476ff.; dto. in der mittelalterlichen Sakralkunst W. Kemp: “Visual Narratives, Memory, and the MedievalEsprit du System”, in: Küchler/Melion (Anm. 13), S. Küchler/W. Melion (Hg.):Images of memory. On remembering and representation, Washington/London 1991, S. 87ff.
N. Leoniceno:In libros Galeni e greca in latinam linguam a se translatos praefatio communis, Venedig 1508. Zur Rolle Galens in der Ausbildung methodischen Denkens vgl. N.W. Gilbert:Renaissance Concepts of Method, New York/London 1960, S. 3ff.
Zu den über Carpo hinausgehenden Beispielen vgl. L. Bolzoni: “Il gioco delle immagini. L'arte della memoria dalle origini al Seicento”, in:La Fabbrica del Pensiero. Dall'Arte della Memoria alle Neuroscienze [Ausstellungskatalog], Mailand 1989, S. 22ff.
S. Serlio:Regole generali di architettura sopra le cinque maniere degli edifici, Venedig 1537/1551. Zu Camillo vgl. P. Rossi (Anm.14):Clavis Universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Mailand/Neapel 1960 und L. Bolzoni:Il teatro della memoria. Studi su Giulio Camillo, Padua 1984.
Zur kosmologischen Bedeutung dieser Transformation der antiken Mnemotechnik im Werk Camillos und Giordano Brunos vgl. P. Rossi (Anm. 4): “, S.15,
S. auch die Studie von L. Olivato: “Dal teatro della memoria al grande teatro dell'architettura: Giulio Camillo e Sebastiano Serlio”,Bollettino del C.I.S.A. 21 (1979), S. 233–252.
Vgl. zur weiteren Entwicklung Kruft (Anm. 32):Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart, München31991, S. 80ff.
Jan Assmann (Anm. 13, S. 107) J. Assmann:Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992. unterscheidet vier Gebrauchsweisen des Kanonbegriffs: “Maßstab, Richtlinie, Kriterium; Vorbild, Modell; Regel, Norm; Tabelle, Liste”.
M. Pardo: “Memory, Imagination, Figuration: Leonardo da Vinci and the Painter's Mind”, in: Kücher/Melion (Anm. 13), S. Küchler/W. Melion (Hg.):Images of memory. On remembering and representation, Washington/London 1991, S. 47–73.
M. Kemp: “Il concetto dell'anima in Leonardo's Early Skull Studies,”,Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 34 (1971), S. 129ff. S. auch M. Pardo, “Memory, Imagination, Figuration: Leonardo da Vinci and the Painter's Mind”, in: Küchler/Melion (Anm. 13), S. Küchler/W. Melion (Hg.):Images of memory. On remembering and representation, Washington/London 1991, S. 220 (Anm.).
P. Rossi (Anm. 5),, S.164
Cicero:De oratore, II.86.352ff.:Dicunt enim, cum cenaret Crannone in Thessalia Simonides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem cecinissetque id carmen, quod in eum scripsisset, in quo multa ornandi causa poetarum more in Castorem scripta et Pollucem fuissent, nimis illum sordide Simonidi dixisse se dimidium eius ei, quod pactus esset, pro illo carmine daturum; reliquum a suis Tyndaridis, quos aeque laudasset, peteret, si ei videretur. Paulo post esse ferunt nuntiatum Simonidi, ut prodiret; iuvenis stare ad ianuam duo quosdam, qui eum magno opere evocarent; surrexisse illum, prodisse, vidisse nemimen: hoc interim spatio conclave illud, ubi epularetur Scopas, concidisse; ea ruina ipsum cum cognatis oppressum suis interisse: quos cum humare vellent sui neque possent obtritos internoscere ullo modo, Simonides dicitur ex eo, quod meminisset quo eorum loco quisque cubuisset, demonstrator unius cuiusque sepeliendi fuisse; hac tum re admonitus invenisse fertur ordinem esse maxime, qui memoriae lumen adferret. (“Man erzählt nämlich, Simonides habe zu Krannon in Thessalien bei Skopas gespeist, einem reichen und vornehmen Mann, und dort ein diesem gewidmetes Gedicht vorgetragen, in dem er-wie das so Dichterart ist-um der Ausschmückung willen auch viele Worte über Castor und Pollux verlor. Daraufhin habe der überaus geizige Skopas zu Simonides gesagt, er werde ihm nur die Hälfte des vereinbarten Honorars auszahlen, die andere möge er sich gefälligst von den Tyndariden besorgen, die er zu gleichen Teilen mit Lob bedacht habe. Kurz darauf, heißt es weiter, habe man Simonides gemeldet, er möge vors Haus kommen, es warteten am Tor zwei junge Männer, die ihn dringend sprechen wollten. Er habe sich erhoben und sei hinausgegangen, habe aber niemanden gesehen. Unterdessen sei der Versammlungsraum, in dem Skopas tafelte, eingestürzt und habe ihn mitsamt den Seinigen unter den Trümmern begraben und zugrunde gerichtet. Als die Angehörigen dann die Toten bestatten wollten, hätten sie die verstümmelten Leichen überhaupt nicht identifizieren können. Da soll SImonides, indem er sich den Sitzplatz eines jeden in Erinnerung rief, jeden einzelnen für das Begräbnis bezeichnet haben. Durch dieses Ereignis belehrt, so erzählt man, habe er herausgefunden, daß es vor allem die Ordnung sei, die dem Gedächtnis ein Licht aufsetzt.”)
J. Assmann (Anm. 13),Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992, S. 33.
Für die erstgenannte Position vgl. z.B. S. N. Eisenstadt (Hg.):Kulturen der Achsenzeit. Ihre Ursprünge und ihre Vielfalt, 2 Bde., Frankfurt/Main 1987, für die andere, die Arbeiten von E. A. Havelock:Schriftlichkeit. Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution, Weinheim 1990, und J. Goody:The Logic of Writing and the Organisation of Society, Cambridge 1986.
Vgl. insbes. die Beiträge von E. Berger und H. Philipp in:Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik, hg.v. H. Beck et al., Mainz 1991. S. auch W. G. Moon (Hg.):Polykleitos, the Doryphoros, and Tradition, Madison, WI/London 1995.
M. Weber:Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen51972, S. 188.
“Die Kanonmetapher postuliert zugleich mit der Konstruktivität der Welt-der Mensch als Baumeister seiner Wirklichkeit, seiner Kultur und seiner selbst-die Letztinstanzlichkeit und Hochverbindlichkeit der Prinzipien, denen solche Konstruktion sich unterwerfen muß, wenn das ‘Haus’ Bestand haben soll.” (Assmann, op. cit. (Anm. 13), S. 127).
Zur Definition des Kanons als “Norm zweiter Ordnung” s. D. Conrad: “Zum Normcharakter von ‘Kanon’ in rechtswissenschaftlicher Perspektive”, in: A. und J. Assmann:Kanon und Zensur, München 1987, S. 46–61.
Ich folge hier nicht Assmanns Sprachgebrauch, sondern übernehme und variiere den Begriff “zweiter Ordnung” von Y. Elkana: “Die Entstehung des Denkens zweiter Ordnung im antiken Griechenland”, in: Eisenstadt (Anm. 47: Bd. 1, S. 52ff.).
Zum Begriff der “großen Tradition” vgl. R. Redfield:Human Nature and the Study of Society, Chicago 1962.
Vgl. zum 12. Jh. C. H. Haskins:The Renaissance of the 12th Century [1927], New York 1961; R. L. Benson/G. Constable (Hg.):Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge, MA 1982 [ND Toronto 1991].
Vgl. auch Assmanns Hinweise auf analoge Entwicklungen in den asiatischen, auf nicht-alphabetische Schriftsysteme gebauten Kulturen (etwa S. 148ff.)
Hier ist kritisch anzumerken, daß die Identitätsbildung nicht nur auf symbolisch strukturierten Kontexten beruht, sondern auch von den je spezifischen Organisationsformen der Arbeit (Ökonomie) und der Herrschaft (Politik) in einer Gesellschaft abhängig ist.
Merkwürdig ist die versteckte Beziehung zwischen Assmanns kulturhistorischen Paradigmen (monumentale Kultur Ägyptens/bewahrend-verehrende jüdische Kultur/wissenschaftlich-kritische Kultur Griechenlands) und den drei historischen “Betrachtungsarten” Nietzsches inVom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben: monumentalische/antiquarische/kritische Historie; “Betrachtungsarten”, die dazu beitragen sollten, unter Wiederanknüpfung an einen Kanon der Meisterwerke die Produktivkräfte der Kultur im Sinne der Remythologisierung wiederzubeleben. Vgl. zu Nietzsche meinen Essay “Kritik der Geschichte im Namen des Lebens. Zur Aktualität von Herders und Nietzsches geschichtstheoretischen Schriften”,Archiv für Kulturgeschichte 68/2 (1986), S. 436 ff.
G. Deleuze:Différence et répétition, Paris41984, S. 36.
Assmann geht kurz auf die Bedeutung der Bilder als Medium des kulturellen Gedächtnisses Ägyptens ein, erkennt aber in der Evolution des spätägyptischen Schriftsystems den entscheidenden “Innovationsschub” (op.cit., S. 192, 265f.).
W. Kemp: “Visual Narratives, Memory, and theEsprit du System” (S. 87ff.); M. Pardo: “Memory, Imgination, Figuration: Leonardo da Vinci and the Painter's Mind” (S. 47ff.); W. Melion: “Hendrick Goltzius” (S. 8ff.); R. Vinograd: “Private Art and Public Knowledge in Later Chinese Painting” (176ff.).
S. Küchler: “Malangan” (S. 27ff.); A. L. Kaeppler: “Memory and Knowledge in the Production of Dance” (S. 109 ff.); G. Feeley-Harnik: “Finding Memories in Madagaskar” (S. 121 ff.); A. G. Miller: “Transformations of Time and Space: Oaxaca, Mexico, circa 1500–1700” (S. 141ff.).
Vgl. etwa die Versuche, über Bildinterpretationen einen Zugang zurFremdheit der griechischen Kultur zu gewinnen, in: C. Bérard, J.-P. Vernant et al. (Hg.):La cité des images, Lausanne 1984.
E. Cassirer:Philosophie der symbolischen Formen, Bd.I:Die Sprache, Darmstadt 1973, S. 23.
“Image schemata that are grounded in our bodily experience are the basis for metaphorical and metonymic mappings by which we understand various nonphysical, abstract domains, such as those of mental processes and epistemic relations.” M. Johnson: “The Imaginative Basis of Meaning and Cognition”, in: Küchler/Melion, op. cit., S. Küchler/W. Melion (Hg.):Images of memory. On remembering and representation, Washington/London 1991, S.85. S. auch H. Weinrich: “Über Sprache, Leib und Gedächtnis”, in:Materialität der Kommunikation, hg.v. H. U. Gumbrecht, K. L. Pfeiffer, Frankfurt/Main 1988, S. 80–93.
“Aus den Horizonten normativer und formativer Wertsetzungen kommen wir nicht heraus”, bemerkt Assmann und weist den “historischen Wissenschaften” die Aufgabe zu, die Kanon-Grenzen ins Bewußtsein zu rufen (op. cit., S. 129). Wie weit sein Ansatz trägt, zeigt auch das von ihm in der Harvard University Press angekündigte BuchMoses the Egyptian: An Essay in Mnemohistory, dessen Inhalt er jüngst im Heidelberger «Gesprächskreis für Kulturanalyse» vorgetragen hat.
P. Veyne:L'inventaire des différences, Paris 1976.
C. Geertz:The Interpreation of Cultures. Selected Essays, New York 1973. Ders.:Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, New York 1993.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Harth, D. Das Gedächtnis der Kulturwis-senschaften und die Klassische Tradition: Erinnern und Vergessen im Licht interdisziplinärer Forschung. International Journal of the Classical Tradition 2, 414–442 (1996). https://doi.org/10.1007/BF02678068
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02678068