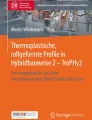Zusammenfassung
In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der wichtigsten Projektergebnisse und Erkenntnisse während der Projektlaufzeit. Inwieweit die zuvor definierten Projektziele erreicht wurden und welche Reduktion von Treibhausgasemissionen sich aufgrund der Planspieldurchführungen ergeben hat, wird in diesem Kapitel erläutert.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der wichtigsten Projektergebnisse und Erkenntnisse während der Projektlaufzeit. Inwieweit die zuvor definierten Projektziele erreicht wurden und welche Reduktion von Treibhausgasemissionen sich aufgrund der Planspieldurchführungen ergeben hat, wird in diesem Kapitel erläutert.
1 Planspieldurchführung in der Praxis
Während der Projektlaufzeit konnten alle Spiele bundesweit mit mehreren Unternehmen getestet werden (siehe dazu auch Abb. 2.1). Das Planspiel zum Thema Lean Production stieß dabei auf die größte Resonanz. Dies kann zum einen damit begründet werden, dass das Thema in produzierenden Unternehmen ein bekanntes Themengebiet ist, bei dem ein hohes ökonomisches Einsparpotenzial erwartet wird. Zum anderen ist das Thema Lean Production ein sinnvolles Einstiegsthema in den Bereich der Energie- und Materialeinsparung, da erst nach der Beseitigung von bestehenden Verschwendungen, weitere sinnvolle Einspar- und Optimierungsmaßnahmen ermittelt und umgesetzt werden können. Das RE:LEAN-Planspiel bot sich damit auch als ein Türöffner für die anderen Planspiele an, die über Lean hinausgehende Möglichkeiten zur Umsetzung von ressourceneffizientem Handeln und damit zur Einsparung von THG vermitteln.
Neben den Unternehmensmitarbeitern konnten auch Berater und Studierende für die Planspiele begeistert werden, welche als Multiplikatoren für eine weitere Verbreitung der Spiele dienen. Durch die im Rahmen des Projekts durchgeführten Train-the-Trainer-Schulungen zur Ausbildung von Spielleitern wird die Multiplikatorwirkung entscheidend verstärkt (weitere Informationen dazu in Abschn. 2.2). Die ausgebildeten Spielleiter wurden befähigt, die Spiele auch nach Projektende in Unternehmen durchzuführen und das Fachwissen und die Handlungskompetenz in den Unternehmen weiter zu stärken.
Die Planspiele können sowohl inhouse als auch extern durchgeführt werden. Während der Pilotphase hat sich gezeigt, dass Unternehmen vorwiegend an Inhouse-Schulungen interessiert sind, um zum einen Reisekosten zu sparen und zum anderen mehrere Mitarbeiter gleichzeitig einzubinden und auf einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen. Dadurch soll langfristig gewährleistet werden, dass sich unterschiedliche Mitarbeiter der Themen der Ressourcenoptimierung annehmen, sich gegenseitig austauschen und im Unternehmen neue Anstöße geben können. Für Multiplikatoren aus unterschiedlichen Beratungsinstitutionen hat sich dagegen gezeigt, dass gemischte Schulungsgruppen besser funktionieren.
2 Erreichte Zielgruppen
Im Laufe des Projekts konnten insgesamt 611 Personen anhand der sechs Planspiele geschult werden (siehe auch Abb. 2.3). Wie in Abb. 2.2 dargestellt, gehörten 307 Personen zur Zielgruppe der Unternehmensmitarbeiter, die aus insgesamt 55 Unternehmen stammten, und 304 Personen zur Zielgruppe der Multiplikatoren (Berater, Studierende, Lehrende etc.).
Da davon ausgegangen werden kann, dass alle Spieler ihr im Spiel erlerntes Wissen als Multiplikatoren an andere Personen weitergegeben haben, kann von einer deutlich größeren Anzahl an indirekt erreichten Personen ausgegangen werden. Zur groben Abschätzung der erreichten Personen und der damit verbundenen Wirkungen wird angenommen, dass jede geschulte/informierte Person mit fünf weiteren Personen über das Thema Ressourceneffizienz gesprochen hat. Dies ist jedoch als eine sehr konservative Annahme zu sehen, da die Effekte voraussichtlich deutlich höher liegen. Denn die Projektnachevaluation hat gezeigt, dass jeder Spieler innerhalb des Unternehmens mit ca. 15 Personen und außerhalb des Unternehmens mit durchschnittlich 25 Personen über das Weiterbildungsangebot und die Relevanz von Ressourceneffizienz gesprochen hat. Zudem haben die Unternehmen in der Nachevaluation angegeben, dass im Schnitt 20 Personen zusätzlich zu den Spielern für die Thematik sensibilisiert wurden sowie noch ca. sechs weitere Personen von der Relevanz von Material- und Energieeffizienzmaßnahmen überzeugt werden konnten.
Durch die Vorstellung der Planspiele auf unterschiedlichen Konferenzen (z. B. auf der Hannover Messe, auf dem Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württemberg) konnten insgesamt ca. 580 Multiplikatoren erreicht werden, die über Planspiele und die vermittelten Methoden anschaulich informiert wurden. Es ist davon auszugehen, dass diese Personen wiederum zur Bekanntmachung der Spiele und der damit verbundenen Methoden beitragen (Abb. 2.3).
3 Evaluationsergebnisse
Zur weiteren Optimierung der Planspielmaterialien sowie zur Abschätzung der Wirkung der Spiele hinsichtlich der Umsetzung von ressourceneffizienten Maßnahmen wurde ein Evaluationskonzept entwickelt. Ziel der Evaluation war es, ein direktes Feedback der Spieler zum Spiel zu erhalten, welches unmittelbar zur Weiterentwicklung und Optimierung genutzt werden konnte. Im Mittelpunkt standen hierbei folgende Fragen:
-
Konnten im Rahmen des Spiels die jeweiligen Lernziele vermittelt werden?
-
Sehen die Spieler Anknüpfungspunkte im Unternehmen?
-
Fühlen sich die Spieler nach dem Spieltag in der Lage, das erlernte Wissen in das eigene Unternehmen zu tragen und idealerweise Veränderungen anzustoßen?
Zur Wirkungsabschätzung wurden sowohl die Spieler als auch die Teamleiter von Inhouse-Schulungen in Unternehmen zusätzlich um ein Feedback zur Bereitschaft des Unternehmens und zu eventuell bestehenden Hemmnissen bei der Umsetzung von Ressourceneffizienzmaßnahmen gebeten. Nicht erfasst wurden dabei Unternehmen, die an gemischten Spielterminen teilgenommen haben. Darüber hinaus wurde ca. drei Monate nach Spieldurchführung mit einigen Unternehmen eine Nachevaluation durchgeführt, um die Umsetzung und den Transfer der erlernten Inhalte auf das eigene Unternehmen abzufragen und Abschätzungen des damit verbundenen THG-Minderungspotenzials zu erhalten. Während der Projektlaufzeit konnte eine Nachevaluation jedoch nur in einem geringen Umfang durchgeführt werden, da ein Großteil der Planspieldurchführungen erst gegen Ende der Projektlaufzeit stattgefunden hat und somit nur wenig Zeit für die Nachevaluation blieb.
Ergebnisse der Teamleiterfragebögen
Von den bei Inhouse-Schulungen in Unternehmen befragten Teamleitern gab es einen Rücklauf von 14 Teamleiterfragebögen, die ausgewertet werden konnten.
Die Planspiele wurden von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, wie Elektroindustrie, chemische Industrie, metallverarbeitende Industrie, Medizintechnik, Automobilindustrie etc., als Weiterbildungsmöglichkeit für ihre Mitarbeiter genutzt. Dabei haben überwiegend größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 50 Mio. EUR das Weiterbildungsangebot gebucht, wobei ein etwas höherer Anteil der erreichten Unternehmen familiengeführt ist.
Die meisten der befragten Unternehmen sind nach DIN ISO 9001, 50001 und 14001 zertifiziert und messen dem Thema Material- und Energieeffizienz eine hohe bis sehr hohe Bedeutung bei. In der Regel wurden daher auch schon vor der Planspieldurchführung Projekte zur Steigerung der Material- und Energieeffizienz im Unternehmen, z. B. im Rahmen von Zertifizierungen nach ISO, durchgeführt. Dabei wurden sowohl energetische Optimierungen als auch Prozessoptimierungen zur Einsparung von Hilfs- und Betriebsstoffen umgesetzt.
Ergebnisse der Spielerfragebögen
Insgesamt wurden über alle sechs Planspiele hinweg 518 Spielerfragebögen ausgewertet. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Vermittlung der Methoden mithilfe der Planspiele sehr gut gelungen ist. Die Spieler geben fast durchweg an, dass sie die im Spiel angewandte Methode verstanden haben (97–100 %) und die Erwartungen der Spieler an das Planspiel meist voll erfüllt oder gar übertroffen wurden.
Die große Mehrheit der Befragten hat darüber hinaus angegeben, dass sie Anknüpfungspunkte bei der Anwendung der Methode im Unternehmen sehen (siehe Abb. 2.4, Hinweis zur Abbildung: die Antwortmöglichkeit „keine Angabe“ wird in der Grafik nicht dargestellt). Die große Mehrheit der Teamleiter und der Spieler hat die eher hohe bis sehr hohe Bereitschaft, Material- und Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, hervorgehoben. Die Unternehmen, die an den Planspielen teilgenommen haben, sind dem Thema gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen und an einer weiteren Umsetzung von Material- und Energieeffizienzmaßnahmen interessiert.
Allerdings wurden sowohl seitens der Teamleiter als auch seitens der Spieler verschiedene im Unternehmen bestehende Hemmnisse bei der Anwendung der erlernten Methoden gesehen. Zeitmangel, aber auch die mit den Maßnahmen verbundenen Investitionskosten wurden dabei als ein Hauptproblem angesehen. Außerdem wurden seitens der Spieler häufig auch die Führungskräfte oder bestehende Hierarchien als eine Hürde zur Umsetzung von Ressourceneffizienzmaßnahmen gesehen (siehe Abb. 2.5). Teamleiter dagegen wiesen auf eine teilweise fehlende Akzeptanz der Umsetzung seitens der Belegschaft hin.
Da die große Mehrheit der Spieler angab, die Planspiele weiterzuempfehlen, ist davon auszugehen, dass das Ziel einer spielerischen, interaktiven und praxisnahen Wissensvermittlung gelungen ist. Die Ergebnisse zeigen damit auf, dass sich die Planspiele sehr gut als ein Tool der Wissensvermittlung eignen und auch ein Weiterbildungsbedarf bei den Unternehmen hinsichtlich der mit den Planspielen vermittelten Methoden besteht. Mithilfe der Planspiele erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, mit einer eintägigen Schulung ihren Mitarbeitern einen ersten Einstieg in das Thema zu ermöglichen, um auf diese Weise später neue Optimierungspotenziale zu entdecken und zu heben.
Ergebnisse der Nachevaluation
Im Rahmen einer Nachevaluation wurde ca. drei Monate nach der Spieldurchführung erhoben, ob und inwiefern die Spiele in den Unternehmen zu ressourceneffizienten Optimierungen und damit auch zur Einsparung von Treibhausgasemissionen beigetragen haben. Da der Großteil der Spiele erst im Jahr 2019 durchgeführt werden konnte, war lediglich bei zehn Unternehmen eine Nachevaluation möglich. Die Nachevaluation erfolgte im Rahmen eines Telefoninterviews mit dem jeweiligen Projektverantwortlichen im Unternehmen. Aufgrund der geringen Fallzahlen lassen sich keine signifikanten Ergebnisse ableiten, aber die Ergebnisse vermitteln zumindest einen ersten Eindruck zur Wirksamkeit der Spiele.
Bei den befragten Unternehmen machen die Materialkosten im Mittelwert ca. 50 % der Gesamtkosten aus. Die Befragten sollten daraufhin eine Einschätzung zum vorhandenen Einsparpotenzial durch die Umsetzung von Materialeffizienzmaßnahmen in ihrem Unternehmen abgeben. Im Durchschnitt wurde ein Einsparpotenzial von ca. 4 % angegeben. Der Energiekostenanteil lag insgesamt lediglich bei ca. 4 %. Für den Energiebereich wurde von den Befragten ein Einsparpotenzial von etwa 8 % angenommen.
Abb. 2.6 verdeutlicht, dass die Spieldurchführungen einen positiven Einfluss auf die Bereitschaft zur Umsetzung wie auch auf die eigentliche Umsetzung von ressourceneffizienten Maßnahmen haben. So soll das Spiel RE:LEAN in einem Unternehmen beispielsweise als Inhouse Training in der unternehmenseigenen Weiterbildungsakademie dauerhaft verankert werden. Ein weiteres Unternehmen hat auf Basis des Planspiels RE:MATERIAL beispielsweise die Kennzahl „Materialeffizienz“ zur Messung der Umweltleistung im EHS-System (EHS = Environmental Health Safety) eingeführt. Die Unternehmensvertreter gaben zudem an, dass die Planspiele zum Abbau von Hemmnissen beitragen konnten, z. B. indem die Geschäftsführung von dem Thema Ressourceneffizienz überzeugt werden konnte oder die Unwissenheit in Bezug auf die eigene Produktion minimiert und Kompetenz bei den Mitarbeitern aufgebaut werden konnte.
Im Rahmen der Nachevaluation sollte eine Schätzung der Material- und Energieeinsparung und der damit verbundenen THG-Minderung abgegeben werden, welche durch die Umsetzung von neuen Projekten in den Unternehmen erreicht wurde. Aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen der Planspieldurchführung und der Befragung zur Nachevaluation waren diesbezüglich noch keine quantitativen Aussagen möglich. Die Unternehmen planen jedoch, Projekte im Bereich der Energie- und Materialeffizienz umzusetzen, sodass weitere Optimierungen sowie Ressourcen- und THG-Einsparungen zu erwarten sind.
4 Beitrag zur Minderung der Treibhausgasemissionen
Ein wichtiges Ziel der Planspiele ist es, einerseits ein Bewusstsein für die Themen CO2 und Klimaschutz zu vermitteln und andererseits durch die Umsetzung von konkreten Maßnahmen in den Unternehmen zu einer Reduktion der THG beizutragen.
Zum Projektende wurde versucht, die bereits erreichten Treibhausgasreduktionen zu quantifizieren, wofür einige Annahmen getroffen werden mussten. Als Grundlage für die weitere Berechnung der Wirkkette wird die Anzahl der direkt und indirekt erreichten Personen durch Schulungsteilnahmen und Teilnahme an Informationsveranstaltungen herangezogen. Die Anzahl an Personen ist notwendig, um ableiten zu können, wie viele Personen nach Kennenlernen eines der Planspiele voraussichtlich THG-mindernde Maßnahmen ergriffen haben. Zur Berechnung der THG-Emissionen wurden die in der Arbeitshilfe zur Ermittlung der THG-Minderungen des BMU beinhalteten Vorgaben und Empfehlungen (Tews et al. 2020) für Beratungsprojekte als Grundlage genutzt. Die getroffenen Annahmen zur Effektivität und Wirkdauer sind jedoch für dieses Projekt als eher konservativ anzusehen, da davon auszugehen ist, dass die im Rahmen des Projekts erreichten Zielgruppen einen höheren Einfluss auf die THG-Emissionen haben. Das lässt sich damit begründen, dass es sich bei dem Projekt um kein reines Beratungsprojekt handelt, sondern um eine fachliche Weiterbildung von Beschäftigten, die direkt in ressourceneffizientes Handeln und damit auch in die Reduzierung von THG-Emissionen mündet.
Tab. 2.1 veranschaulicht, wie viele Personen im Rahmen des Projekts zur THG-Minderung beitragen haben.
Im Rahmen des Projekts haben insgesamt 611 Personen (Gruppe 1) an Spieldurchführungen teilgenommen. Das waren in der Regel hoch motivierte und interessierte Personen aus Unternehmen und diversen Institutionen, oft mit Entscheidungskompetenz. Es ist davon auszugehen, dass viele der Teilnehmer im Nachgang auch tatsächlich ressourceneffizientes Handeln umsetzen und damit zu einer THG-Minderung beitragen. Die in der Arbeitshilfe zur Ermittlung der THG-Minderung für sehr intensive Beratungen nach Tews et al. (2020, S. 8) vorgeschlagene Standardzahl von 15 % für die Effektivität der Maßnahme dürfte deshalb als absolute Untergrenze betrachtet werden. Zusätzlich zu den Spielteilnehmern haben 148 Personen an den Trainerschulungen (Gruppe 2) teilgenommen. Dieser Personenkreis ist noch motivierter, es wurden immerhin zwei ganze Arbeitstage geopfert. Zudem sind nach der Trainerschulung auch weitere Beratungstätigkeiten im Bereich Ressourceneffizienz möglich. Es ist davon auszugehen, dass ebenfalls mindestens 15 % der Trainer selbst auch THG-mindernde Maßnahmen initiieren. Dazu kommen weitere Personen, die durch Informationsveranstaltungen, Messestände und Ähnliches erreicht wurden (Gruppe 3: 576 Personen mit einer Effektivität von 2 %), sowie Personen, die indirekt durch die Teilnehmer der Schulungen und der Infoveranstaltungen erreicht wurden (Gruppe 4: 6675 Personen mit einer Effektivität von 1 %). Die Zielgruppen werden in Abschn. 2.2 beschrieben. Auf Basis dieser Annahmen ergreifen ca. 193 Personen konkrete Maßnahmen, die zu einer THG-Minderung beitragen (Tab. 2.1).
Als schwierig erweist sich die Abschätzung des THG-Einsparpotenzials der getroffenen Maßnahmen. Das baden-württembergische Projekt „100 Betriebe für Ressourceneffizienz“ umfasste ca. 100 Einzelbeispiele, d. h. Einzelmaßnahmen der verschiedensten Art aus dem Material- und Energiebereich, aus organisatorischen und technischen Maßnahmen, und führte, wie bereits in Abschn. 1.4 ausgeführt, zu CO2-Einsparungen in Höhe von ca. 350.000 t pro Jahr. Das Verhältnis von material- zu energiebezogenen Maßnahmen betrug dabei 1/3 zu 2/3. Pro Maßnahme (und meistens auch pro kleine und mittlere Unternehmen) liegt die Einsparung also bei einigen 1000 t CO2eq pro Jahr.
Ein anderer Ansatz geht von folgenden Annahmen aus:
-
1.
Wie groß sind die CO2-Emissionen pro Beschäftigtem?
-
2.
Wie groß ist das Einsparpotenzial?
-
3.
Auf wie viele Beschäftigte wirkt eine Person ein, die eine Schulung mitgemacht hat oder dadurch beeinflusst wird?
Zu 1.: Da bei den THG-Emissionen auch der Beitrag durch den Materialeinsatz mitberücksichtigt werden soll, können nicht nur die direkten Emissionen einer Branche (Scope 1) oder jene durch die Energiebereitstellung (Scope 2) betrachtet werden, sondern auch die indirekten durch Vorleistungen (Scope 3). Solche Gesamtemissionen sind jedoch für einzelne Branchen (z. B. verarbeitende Industrie – Gruppe C der Wirtschaftsstatistik) sehr schwierig zu ermitteln. Deshalb wird von der Produktion in der Industrie einschließlich der Bauwirtschaft ausgegangen. Dieser Wert lag 2017 in Deutschland bei etwa 2 · 108 t CO2eq/a (Umweltbundesamt 2020), die dazu korrespondierende Beschäftigtenzahl bei ca. 9,7 Mio. Personen (Statistisches Bundesamt 2020). Dies wird als Bezugsgröße für die Emissionen verwendet: Das entspricht einem CO2-Ausstoß von ca. 21 t CO2eq/a pro Beschäftigtem.
Zu 2.: In der großen MaRess-Studie im Auftrag des BMU wurde darauf hingewiesen, dass im Durchschnitt 20 % der Materialkosten der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe langfristig reduziert werden könnten (Diestelkamp et al. 2010, S. 35 f.), was in erster Näherung auch auf die THG-Emissionen übertragen werden kann. Dieser Wert ist allerdings theoretisch. Empirisch hat die DEMEA allein im Bereich der Materialeffizienz bei über 1000 Potenzialstudien in KMU ein monetäres Einsparpotenzial (gemessen am Umsatz) von im Durchschnitt knapp 2 % ermittelt (Schmidt und Schneider 2010). Bei den von der DEMEA genannten 2 % handelt es sich um sehr konservative Schätzungen, da nur direkte Einsparungen berücksichtigt wurden. Außerdem fehlen Maßnahmen im Energiebereich.
Die Ergebnisse der Nachevaluation (siehe Abschn. 2.3) haben ergeben, dass die Unternehmen eher von einem Einsparpotenzial im Materialbereich von bis zu 4 % und im Energiebereich sogar von bis zu 8 % ausgehen. Das entspricht in etwa den Verhältnissen zwischen dem Material- und Energiebereich, die in der oben genannten baden-württembergischen Studie ermittelt wurden.
Im Folgenden wird deshalb mit dem vorsichtigen Wert von ca. 6 % Einsparpotenzial gerechnet. Die Einsparpotenziale betreffen teilweise direkt den Energieeinsatz in der Produktion, z. B. durch Verwendung ineffizienter Motoren, Aggregate und Druckluftsysteme, fehlende Wärmerückgewinnung, mangelhafte Standby-Schaltungen oder nicht adäquate Heizung und Beleuchtung, die sich direkt auf die THG-Emissionen auswirken. Außerdem wird die emissionsreduzierende Wirkung bei Materialeinsparungen, also bei geringerem Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffeinsatz berücksichtigt. Denn mit jedem eingesetzten Material ist ein THG-Rucksack verbunden, jedes eingesparte Material führt folglich zu einer Emissions-Minderung über den gesamten Industrieprozess, die sich damit auch auf die vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette auswirkt.
Die Wirkungsdauer dieser Maßnahmen lässt sich nur schwer abschätzen. Ordnet man organisatorische Maßnahmen den Verhaltensänderungen zu, so läge der Standardwert bei zwei Jahren (Tews et al. 2020, S. 13), was aber eher gering wäre. Bei technischen Maßnahmen kann von acht Jahren ausgegangen werden. Wir gehen im Mittel von vier Jahren aus, wobei investive Maßnahmen meistens eine deutlich längere Wirkung entfalten.
Geht man von einem THG-Ausstoß von ca. 21 t CO2eq/a pro Mitarbeiter aus, so ergeben 6 % Einsparpotenzial einen Wert von ca. 1,3 t CO2eq/a pro Mitarbeiter und über die Wirkdauer von vier Jahren gerechnet insgesamt ca. 5,2 t CO2-Minderung pro Mitarbeiter.
Zu 3.: Typischerweise sind die Planspielteilnehmer Angehörige des unteren oder mittleren Managements. Sie sind häufig für den Produktionsbetrieb oder den Umwelt-/ Nachhaltigkeitsbereich eines kleinen oder mittleren Betriebs verantwortlich oder sie verantworten Teilbereiche eines größeren Unternehmens oder Konzerns. Diese Personen tragen ihr erlerntes Wissen in das Unternehmen hinein und initiieren dort Verbesserungsmaßnahmen und leiten weitere Personen im Unternehmen bei der Umsetzung an. Um die im Unternehmen beeinflussbaren THG-Emissionen zu berechnen, schätzen wir den Einfluss dieser Personen auf ca. 100 Mitarbeiter im Unternehmen. Diese Zahl stellt lediglich eine rechnerische Größe dar und steht damit stellvertretend für die anteiligen THG-Emissionen des Unternehmens bzw. des möglichen Einsparpotenzials. Jede Person, die durch die Schulungen direkt oder indirekt zur THG-Minderung beiträgt und einen Unternehmensbereich mit ca. 100 Beschäftigten beeinflusst, hat damit ein Einsparpotenzial von 520 t CO2eq. Bezogen auf die in Tab. 2.1 errechnete Anzahl an Personen ergibt sich ein Einsparpotenzial von ca. 100.000 t CO2eq (siehe Abb. 2.7).
Weitere Auswirkungen nach Projektende
Auch nach Projektende ist aufgrund der ausgebildeten Trainer mit weiteren THG-Minderungen zu rechnen, wenn diese die Planspiele anwenden. Die erwartete Minderung ist in Tab. 2.2 dargestellt.
Perspektivisch gesehen ist davon auszugehen, dass nach Projektende mindestens 15 % der während der Projektlaufzeit ausgebildeten 148 Trainer selbst Schulungen durchführen werden. Ausgehend von der Annahme, dass diese Trainer im Schnitt fünf Planspiele pro Jahr mit ca. acht Teilnehmern durchführen, könnten damit weitere 1760 Personen (Gruppe 5) innerhalb der nächsten zwei Jahre direkt mit Spieldurchführungen erreicht werden. Außerdem kann auch bei dieser Personengruppe davon ausgegangen werden, dass diese wiederum indirekt weitere Personen erreichen und zur Umsetzung von Maßnahmen motivieren können (hier kommt wieder der Faktor 5 zur Berechnung der indirekt erreichten Personen mit einer Effektivität von 1 % zum Tragen). Für die Zukunft kann damit weiteres Einsparpotenzial in der in Abb. 2.8 dargestellten Höhe erwartet werden.
Damit kann durch das RE:PLAN-Projekt insgesamt eine THG-Minderung von ca. 283.000 t CO2eq erzielt werden (100.000 t CO2eq während der Projektlaufzeit zuzüglich 183.000 t CO2eq nach Projektende). Dieser Wert ist als konservativ anzusehen. Selbst wenn diese Zahl aufgrund der Unsicherheiten der Berechnung um einen Faktor 5 zu hoch wäre, so wäre das Forschungsprojekt immer noch günstiger als die derzeit geplante CO2-Bepreisung von 25 EUR/t. Dies unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen in diesem Weiterbildungsbereich.
Literatur
Diestelkamp M, Meyer B, Meyer M (2010) Quantitative und Qualitative Analyse der ökonomischen Effekte einer forcierten Ressourceneffizienzstrategie. Abschlussbericht zu AR5 des MaRess-Vorhabens für BMU/UBA
Schmidt M, Schneider M (2010) Kosteneinsparungen durch Ressourceneffizienz in produzierenden Unternehmen. Umweltwirtschaftsforum 18:153–164
Statistisches Bundesamt (Destatis) (2020) Unternehmen, Tätige Personen, Umsatz, Investitionen, Bruttowertschöpfung, -betriebsüberschuss, Personalaufwend: Deutschland, Jahre, Unternehmensgröße, Wirtschaftsbereiche (Tabelle 48121-0002). https://www-genesis.destatis.de. Zugegriffen: 25. März 2020
Tews K, Schumacher K, Eisenmann L, Saupe A, Zacharias-Langhans K (2020) Arbeitshilfe zur Ermittlung der Treibhausgasminderung. Nationale Klimaschutzinitiative, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/2020-01_BMU-NKI_Arbeitshilfe-Ermittlung-THG-Minderung.pdf. Zugegriffen: 3. März 2021
Umweltbundesamt (2020) Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen 1990–2017. Endstand zur Berichterstattung 2019. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/2018_12_19_em_entwicklung_in_d_trendtabelle_thg_v1.0.1_0.xlsx. Zugegriffen: 18. Aug. 2020
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Anstätt, K., Schmidt, M., Bertagnolli, F. (2022). RE:PLAN Projektergebnisse. In: Anstätt, K., Bertagnolli, F., Schmidt, M. (eds) Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64071-5_2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-64071-5_2
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-64070-8
Online ISBN: 978-3-662-64071-5
eBook Packages: Business and Economics (German Language)