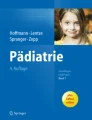Zusammenfassung
Antimikrobielle Therapie ist eine Heilmethode zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Die Erreger werden im Wirtsorganismus abgetötet oder an der Vermehrung gehindert, ohne die Zellen des Wirtes zu schädigen (Prinzip der selektiven Toxizität). Das Kapitel enthält eine erregerspezifische Einteilung der Substanzen und umreißt einige historische Meilensteine der Entwicklung von Chemotherapeutika.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Antimikrobielle Therapie ist eine Heilmethode zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Die Erreger werden im Wirtsorganismus abgetötet oder an der Vermehrung gehindert, ohne die Zellen des Wirtes zu schädigen (Prinzip der selektiven Toxizität). Das Kapitel enthält eine Einteilung der Substanzen gemäß den Zielorganismen und umreißt einige historische Meilensteine der Entwicklung von Chemotherapeutika.
2 Historie
Gezielte antiinfektiöse Therapie wurde erstmals im 17. Jahrhundert von Jesuiten aus Peru berichtet, wo Eingeborene die Malaria erfolgreich mit der Rinde des Chinabaums (»quina-quina«) behandelten.
Paul Ehrlich (1854–1915, Nobelpreis 1908) entwickelte den Gedanken, dass Farbstoffe mit spezifischer Affinität für pathogene Mikroorganismen im Sinne einer »magischen Kugel« selektiv toxisch auf diese einwirken und sich zur Therapie von Infektionskrankheiten eignen müssten. 1891 legte er mit der Anwendung von Methylenblau bei der Behandlung der Malaria den Grundstein für die antimikrobielle Therapie. Zusammen mit Sahachiro Hata (1873–1938) schaffte er 1910 mit der Einführung des Salvarsans den Durchbruch in der Therapie der Syphilis und anderer Spirochätosen.
Gerhard Domagk (1895–1964, Nobelpreis 1939) führte die Untersuchungen über die antimikrobiellen Wirkungen von Azofarbstoffen weiter. Mit der Synthese von 2’,4’-Diaminoazobenzol-N4-Sulfonamid (Handelsname Prontosil) gelang 1935 die entscheidende Entdeckung. Damit war erstmals möglich, bakterielle Infektionen zu heilen.
Alexander Fleming (1881–1955) entdeckte 1928 das Penicillin aufgrund der Beobachtung, dass in der Umgebung einer Kultur von Penicillium notatum auf einem festen Kulturmedium die Vermehrung von Staphylokokken gehemmt war. Es wurde 1939 von Howard Walter Florey (1898–1968) und Ernst Boris Chain (1906–1979), dem sog. »Oxford-Kreis«, in reiner Form dargestellt und 1941 in die Therapie eingeführt (Nobelpreis 1945 an Fleming, Chain und Florey).
Nachdem Domagk 1941 mit dem Sulfathiazol die erste gegen M. tuberculosis wirksame Substanz vorgestellt hatte, entdeckte Albert Schatz, Doktorand von Selman Abraham Waksman (1888–1973, Nobelpreis 1952) 1943 das Aminoglykosid Streptomycin, das 1946 als erstes Antituberkulotikum Eingang in die Therapie fand. Diesem folgte das Isoniazid (Kurzname für Isonikotinsäurehydrazid, INH), das 1952 ebenfalls Domagk vorstellte.
In rascher Folge fanden dann weitere Substanzklassen und Modifikationen bekannter Substanzen Eingang in die Therapie.
Literatur
Lorian V (2005) Antibiotics in Laboratory Medicine, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Stille W et al. (2005) Antibiotika-Therapie, 11. Aufl. Stuttgart: Schattauer.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2016 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Dierich, M.P., Fille, M. (2016). Allgemeines. In: Suerbaum, S., Burchard, GD., Kaufmann, S., Schulz, T. (eds) Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48678-8_87
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-48678-8_87
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-48677-1
Online ISBN: 978-3-662-48678-8
eBook Packages: Medicine (German Language)