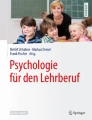Zusammenfassung
Im letzten Kapitel von Andere Sichtweisen auf Intersektionalität: Revisualising Intersectionality unterstreichen Nowicka und Haschemi Yekani die Notwendigkeit einer transdisziplinären Rekonzeptualisierung der visuellen Verankerung von Differenz in der wissenschaftlichen Wissensproduktion. In der kognitiven und in der psychologischen Forschung muss die gewohnheitsmäßige Verwendung von Geschlecht oder race als Kategorien, die durch visuelle Eindrücke erschlossen werden können, hinterfragt werden. In den Sozialwissenschaften kann eine sorgfältige Analyse von skopischen Differenzregimen dazu beitragen, Vereinfachungen sowohl des sozialen Konstruktivismus als auch des biologischen Determinismus zu überwinden. Bei der Analyse kultureller Repräsentation sollten zirkuläre Erklärungsmodelle vermieden werden, die vorgeben, dass Stereotypen ‚schlechte Bilder‘ erzeugten, denen durch ‚positive Bilder‘ entgegengewirkt werden könnte. Daher schlagen die Autorinnen vor, von künstlerischer Forschung und Praxis zu lernen, um einen anderen Blickwinkel einzunehmen und vorgefasste Ordnungen zu durchbrechen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Auch Paul Gilroy (2001) schlägt vor, auf race als eine analytische Kategorie, die Unterdrückungsformen eher hervorbringt als auflöst, zu verzichten.
- 2.
Dies wirkt sich auch auf Möglichkeiten zur Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen aus, wie die Vorschläge zur Streichung des Begriffs „Rasse“ aus Rechtsdokumenten zeigen, wie sie derzeit in Deutschland diskutiert werden und in Frankreich bereits umgesetzt wurden, um zu signalisieren, dass es keine biologischen „Rassen“ gibt. Es existieren unterschiedliche Auffassungen darüber, was die Ersetzung von Begriffen wie race oder „Rasse“ durch eine Formulierung wie „rassistische Diskriminierung“ für die zukünftige Entwicklung von Antidiskriminierungsrecht bedeuten könnte. Vgl. z. B. die öffentlich zugängliche Diskussion mit Tahir Della, Natasha A. Kelly, Doris Liebscher und Emilia Roig, zu der online eine Mitschrift verfügbar ist: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1150347.rasse-im-grundgesetz-benennen-oder-verbannen.html (Zugriff am 30. Juni 2021). Für eine Diskussion über Farbenblindheit und Rassismusleugnung in Frankreich vgl. Roig (2017) und Perkins (2019).
- 3.
Vgl. Walgenbach et al. (2012), die eine transdisziplinäre Diskussion darüber führen, wie Geschlecht als eine interdependente statt intersektionale Kategorie verstanden werden sollte.
- 4.
- 5.
Lakoff (1987) führt Beispiele dafür an, wie die Kategorie ‚Mutter‘, wenn sie mit dem Stereotyp ‚Hausfrau‘ verbunden wird, mit den Konzepten Geburt, rechtliche Bindung, bezahlte Arbeit und Fürsorge zusammenfällt (Lakoff 1987), wodurch sie eine bestimmte Bedeutung erhält. Es gibt also nichts essentiell ‚Mütterliches‘, das, wenn es von Konzepten der Hausfrau innerhalb des rechtlichen und wirtschaftlichen Regimes der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung losgelöst würde, zu Unterdrückung führen würde (vgl. Hernando 2017).
- 6.
Vgl. Boisvert (2010) zu gegenseitiger Wechselbeziehung im Rahmen des Zusammenlebens (convivial interrelatedness) als eine Möglichkeit, über Unterschiede hinweg zueinander in Beziehung zu treten.
- 7.
Dabei ist es wichtig, Konzepte wie Mestizaje oder Hybridität nicht einfach als Überwindung kultureller Verwurzelung (und somit z. B. als im Gegensatz zu Indigenität stehend) misszuverstehen, sondern von vornherein als Widerstand gegen die koloniale Ordnung überhaupt zu behandeln.
- 8.
Lugones schlägt auch verschiedene Techniken vor, wie der Fragmentierung widerstanden werden kann. Dazu gehören Codeswitching; Kategorien verschwimmen zu lassen und durcheinanderzubringen; Geschlechtertransgressionen; ein Durchtränken mit Mehrdeutigkeit; sich in Schummelei und Albernheit zu üben; sowie viele andere (1994, S. 478).
Literatur
Anthias, Floya. 2021. Translocational Belongings: Intersectional Dilemmas and Social Inequalities. Abingdon und New York: Routledge.
Anthias, Floya und Nira Yuval-Davis. 1993. Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-Racist Struggle. New York: Routledge.
Anzaldúa, Gloria. 1987. Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books.
Boisvert, Raymond D. 2010. Convivialism: A Philosophical Manifesto. The Pluralist 5 (2): 57–68. https://doi.org/10.1353/plu.2010.0001.
Carastathis, Anna. 2016. Intersectionality. Origins, Contestations, Horizons. Lincoln: University of Nebraska Press.
Crary, Jonathan. 1999. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. Cambridge: MIT Press.
Deroy, Ophelia. 2019. Categorising Without Concepts. Review of Philosophy and Psychology 10 (3): 465–478. https://doi.org/10.1007/s13164-019-00431-2.
Gilroy, Paul. 2001. Against Race. Imagining Political Culture Beyond the Color Line. 4. Auflage. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
Haarmann, Anke. 2019. Artistic Research. Eine epistemologische Ästhetik. Bielefeld: transcript.
Hernando, Almudena. 2017. The Fantasy of Individuality: On the Sociohistorical Construction of the Modern Subject. Cham: Springer.
Kalish, Charles W. 1995. Essentialism and Graded Membership in Animal and Artifact Categories. Memory & Cognition 23 (3): 335–353. https://doi.org/10.3758/BF03197235.
Keil, Frank C. 1992. Concepts, Kinds, and Cognitive Development. Cambridge. MIT Press.
Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press.
Lentin, Alana. 2008. Europe and the Silence about Race. European Journal of Social Theory 11(4): 487–503. https://doi.org/10.1177/1368431008097008.
———. 2015. What Does Race Do? Ethnic and Racial Studies 38 (8): 1401–1406. https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1016064.
Lugones, Maria. 1994. Purity, Impurity, and Separation. Signs 19 (2): 458–479.
Perkins, Vinecia. 2019. The Illusion of French Inclusion: The Constitutional Stratification of French Ethnic Minorities. Georgetown Journal of Law & Modern Critical Race Perspectives 11 (2): 181–203.
Reed, Touré F. 2020. Toward Freedom: The Case against Race Reductionism. London und New York: Verso.
Roig, Emilia. 2017. Uttering ‘Race’ in Colorblind France and Post-Racial Germany. In Rassismuskritik und Widerstandsformen, Hrsg. Karim Fereidooni und Meral El, 613–627. Wiesbaden: Springer.
Travers, Eoin, Merle T. Fairhurst und Ophelia Deroy. 2020. Racial Bias in Face Perception Is Sensitive to Instructions but Not Introspection. Consciousness and Cognition 83: 102952. https://doi.org/10.1016/j.concog.2020.102952.
Walgenbach, Katharina, Gabriele Dietze, Lann Hornscheidt und Kerstin Palm. 2012. Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität. 2. korr. Auflage. Opladen: Budrich.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Nowicka, M., Haschemi Yekani, E. (2022). Schluss: Intersektionalität anders gesehen. In: Andere Sichtweisen auf Intersektionalität . Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38757-0_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-38757-0_5
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-38756-3
Online ISBN: 978-3-658-38757-0
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)