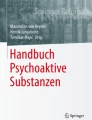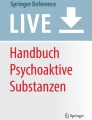Zusammenfassung
Ausgehend von einer Unterscheidung dreier methodischer Phasen der bundesrepublikanischen Staatsrechtslehre analysiert der Beitrag die methodische wie inhaltliche Dimension des verfassungsrechtswissenschaftlichen Dogmatisierungsprozesses, der sich seit der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre für einen Zeitraum von circa 25 Jahren vollzogen hat. Die Hauptthese lautet, dass sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die sie dogmatisch aufbereitende Verfassungsrechtslehre als Ausdruck einer liberaletatistischen Ordnungsvorstellung rekonstruieren lassen. Diese „Verfassungsdogmatik der Bürgerlichkeit“ sieht sich seit einigen Jahren sowohl externer Herausforderungen (Autoritarismus, Klimakrise, Digitalisierung) als auch wissenschaftsinterner Anfechtungen (u. a. Kontextualisierung, relationales Freiheitsverständnis) ausgesetzt, in deren Folge die Verfassungsrechtswissenschaft in eine vierte, als „multiparadigmatisch“ zu beschreibende Phase eingetreten ist.
Der Verfasser dankt Simon Pielhoff sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forschungskolloquiums des Jungen Arbeitskreises Recht und Politik an der Ruhr-Universität Bochum am 29.07.2022 für wertvolle Anregungen.
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
So die in den wesentlichen Zügen übereinstimmenden Charakterisierungen der Staatsrechtslehre der 1950er Jahre bei Stolleis, ZRG GA 124 (2007), S. 223 (237 f.); C. Möllers, Der vermisste Leviathan, 2008, S. 33 ff.; Günther in diesem Band.
- 2.
Hierzu und zum Folgenden näher und m. w. N. Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (289 ff.).
- 3.
Neumann/Nipperdey/Scheuner (Hg.), Die Grundrechte, 7 Teilbd., ab 1954.
- 4.
Isensee/Kirchhof (Hg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 7 Bd., ab 1987.
- 5.
Zu der auf Ludwik Fleck zurückgehenden wissenssoziologischen Kategorie des Denkstils Lepsius, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hg.), 2. Aufl. 2021, S. 53 (54 ff.).
- 6.
Hesse, in: Krüper/Payandeh/Sauer (Hg.), 2019, S. 1–18. Zur wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung der Antrittsvorlesung siehe die dort versammelten Beiträge von Rainer Wahl (S. 19–47), Anna Katharina Mangold (S. 49–62) und Matthias Jestaedt (S. 63–84).
- 7.
Jesch, Gesetz und Verwaltung, 1961. Zur wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung der Habilitationsschrift siehe Lepsius, JZ 2004, S. 350–351; C. Schönberger, in: Stolleis (Hg.), 2006, S. 53 (76 ff.); Augsberg, in: Kremer (Hg.), 2017, S. 287–304.
- 8.
Felsch, Der lange Sommer der Theorie, 2015.
- 9.
Suhr, Entfaltung des Menschen durch die Menschen, 1976, S. 19.
- 10.
Siehe nur die Beiträge in Friedrich (Hg.), Verfassung, 1978.
- 11.
Siehe nur die Beiträge in Böckenförde (Hg.), Staat und Gesellschaft, 1976.
- 12.
Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967–1977, 2001.
- 13.
Näher und m. w. N. Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (310 ff.).
- 14.
Benda/Maihofer/Vogel, in: dies. (Hg.), 1984, S. V. Siehe auch Grimm, in: ders., 1991, S. 300–311; Lübbe-Wolff, Der Staat 23 (1984), S. 577–589.
- 15.
Zeitgenössisch repräsentativ Kloepfer, in: Rüthers/Stern (Hg.), 1984, S. 199 (205 ff.).
- 16.
Meinel, in: Cancik u. a. (Hg.), 2022, S. 733 (750): „Das Öffentliche Recht wurde nach 1968 auf lange Sicht nicht politischer, sondern ganz im Gegenteil unpolitischer, technischer, praktischer.“
- 17.
Unübertroffen: Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bände III/1 (1988) und III/2 (1994).
- 18.
Grimm (Hg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, 2 Bände, 1976; Hoffmann-Riem (Hg.), Sozialwissenschaften im Studium des Rechts, Bd. II: Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 1977.
- 19.
Diese Beobachtung verdanke ich Christoph Schönberger.
- 20.
Im Gegenteil trieb die Wiedervereinigung die Dogmatisierung weiter voran, zu den Gründen C. Möllers, Der vermisste Leviathan, 2008, S. 69 ff.; C. Schönberger, Der „German Approach“, 2015, S. 42 f.
- 21.
Näher und m. w. N. Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (319 ff.)
- 22.
Jestaedt, in: ders. u. a., 2011, S. 77 (126).
- 23.
Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (328 f. m. w. N.).
- 24.
Vgl. Grimm, German Law Journal 22 (2021), S. 1541 (1546); Huber, FAZ v. 06.04.2023, S. 8.
- 25.
BVerfGE 92, 1 [1995] – Sitzblockade II.
- 26.
BVerfGE 93, 1 [1995] – Kruzifix.
- 27.
BVerfGE 93, 266 [1995] – Soldaten sind Mörder.
- 28.
So Schulze-Fielitz, AöR 122 (1997), S. 1 (27); dazu auch Schaal in diesem Band.
- 29.
Exemplarisch: Ridder, in: Römer (Hg.), 1977, S. 70–86.
- 30.
Exemplarisch: Scholz/Konrad, AöR 123 (1998), S. 60–121. Für eine Unterscheidung dieser Kritikphasen Collings, in: Meinel (Hg.), 2019, S. 63 (71 ff.).
- 31.
Siehe neben den Beiträgen in Häberle (Hg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, 1976, etwa noch Grimm, in: ders., 2021, S. 37–60; Häberle, in: ders., 2014, S. 49–70; Schlaich, VVDStRL 39 (1981), S. 99 (106 ff.); Bryde, Verfassungsentwicklung, 1982, S. 325 ff; Ebsen, Das Bundesverfassungsgericht als Element gesellschaftlicher Selbstregulierung, 1985; Gusy, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, 1985.
- 32.
Zu den wenigen Ausnahmen gehören Heun, Funktionell-rechtliche Schranken der Verfassungsgerichtsbarkeit, 1992; Haltern, Verfassungsgerichtsbarkeit, Demokratie und Mißtrauen, 1998, bes. S. 169 ff.; Würtenberger, in: Guggenberger/Würtenberger (Hg.), 1998, S. 57 (70 ff.).
- 33.
BVerfGE 93, 121 (152, 162 f.) [1995] – Einheitswerte II, Abweichende Meinung des Richters Böckenförde; siehe ferner Böckenförde, Der Staat 29 (1990), S. 1 (24 ff.); Böckenförde, NJW 1999, S. 9 (13 ff.).
- 34.
Näher und m. w. N. Cornils, in: Menzel/Müller-Terpitz (Hg.), 3. Aufl. 2017, S. 852 (857 ff.).
- 35.
Huber, Der Staat 56 (2017), S. 389 (414).
- 36.
Jestaedt u. a., Das entgrenzte Gericht, 2011.
- 37.
Dazu näher und m. w. N. Krüper, RG 23 (2015), S. 16 (37 ff.); Schulze-Fielitz, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hg.), 2. Aufl. 2021, S. 353–389.
- 38.
Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland, Drs. 2558-12, 2012.
- 39.
Siehe nur C. Möllers, in: Jestaedt u. a., 2011, S. 281 (308 ff.); Volkmann, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hg.), 2013, S. 119–138; Depenheuer, in: Hillgruber (Hg.), 2014, S. 79–117; Petersen, Verhältnismäßigkeit als Rationalitätskontrolle, 2015, Kap. 1; Kaiser/Wolff, Der Staat 56 (2017), S. 39–76; Münkler, Expertokratie, 2020, S. 624 ff.; Scheid, Der Staat 59 (2020), S. 227–276; Nußberger, VVDStRL 81 (2022), S. 7 (24 ff.).
- 40.
Es ist jedenfalls kein Zufall, dass sich gegenwärtig eine Rekanonisierung von Verfassungsdenkern beobachten lässt, die, obwohl sie den staatsrechtlichen Diskurs der 1970er-Jahren maßgeblich geprägt hatten, in den Folgejahrzehnten weitgehend in Vergessenheit gerieten: Helmut Ridder, Wiltraut Rupp-von Brünneck und Dieter Suhr. Alle drei zeichnen sich durch eine spezifische Verbindung von Methode und Thema aus: streng positivistische Grundgesetzlektüre und Gesellschaftskritik (Ridder), Pragmatismus und demokratische Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit (Rupp-von Brünneck), sozialphilosophisch aufgeklärte Grundrechtsdogmatik und interaktionistisches Grundrechtsmodell (Suhr). Zum Verfassungsdenken Ridders jetzt umfassend: Feichtner/Wihl (Hg.), Gesamtverfassung, 2022; zur Verfassungswirklichkeit als Bezugspunkt des Demokratieverständnisses Rupp-von Brünnecks eingehend: Michl, Wiltraut Rupp-von Brünneck, 2022, S. 444 ff., 448 ff.; zu Methoden und Themen Suhrs: von Landenberg-Roberg, in: Marsch/Münkler/Wischmeyer (Hg.), 2018, S. 151–170.
- 41.
Jansen, in: Augsberg/Schuppert (Hg.), 2022, S. 487 (499 f.).
- 42.
Ebd., S. 488.
- 43.
BVerfGE 144, 20 (202 ff.) [2016] – NPD-Verbotsverfahren.
- 44.
Die Präzisierung dieses Gedankens verdanke ich Oliver Weber.
- 45.
Siehe nur Stern, Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Recht und Politik, 1980; Piazolo (Hg.), Das Bundesverfassungsgericht. Ein Gericht im Schnittpunkt von Recht und Politik, 1995; Grimm, in: ders., 2021, S. 153–171; Hwang, in: dies., 2018, S. 177–201.
- 46.
Grimm, in: ders., 2021, S. 89–104.
- 47.
Kelsen, Reine Rechtslehre, Studienausgabe der 2. Auflage 1960, 2017, S. 598 ff.
- 48.
So auf dem Boden einer dualistischen Rechtsgewinnungstheorie Jestaedt, in: Vesting/Korioth (Hg.), 2011, S. 317 (330).
- 49.
Eine verwandte, aber nicht identische Unterscheidung zwischen politisch im Sinne von parteipolitisch und politisch im Sinne von demokratiefunktional bei Lepsius, APuZ 37/2021, S. 13 (15).
- 50.
Robertson, The Judge as Political Theorist, 2010. Zu den Gründen, warum das BVerfG als genuiner Theorieproduzent nicht in Betracht kommt: Voßkuhle, in: ders./Bumke/Meinel (Hg.), 2013, S. 371 (371 ff.).
- 51.
Im methodischen Ansatz, aber nicht unbedingt in der Deutung ähnlich: Brugger, in: ders., 1999, S. 253 (270 ff.); Haltern, Verfassungsgerichtsbarkeit, Demokratie und Mißtrauen, 1998, § 9; Nettesheim, Liberaler Verfassungsstaat und gutes Leben, 2017, S. 24 ff.
- 52.
Anders der Zugriff bei van Ooyen, Bundesverfassungsgericht und politische Theorie, 2015; van Ooyen/ M. H. W. Möllers, „Der Staat ist von Verfassungs wegen nicht gehindert …“, 2021.
- 53.
Ähnliche Beschreibung bei Waldhoff, in: Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), 2012, S. 17 (32 ff.).
- 54.
Allgemein zum Systemdenken in der Rechtswissenschaft Hilbert, Systemdenken in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft, 2015; speziell zum Systemdenken in der Verfassungsrechtswissenschaft Hain, in: Starck (Hg.), 2004, S. 45–56.
- 55.
Boulanger, in: ders./Rosenstock/Singelnstein (Hg.), 2019, S. 173–192.
- 56.
In diese Richtung aber Schulze-Fielitz, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hg.), 2. Aufl. 2021, S. 353 (387 ff.).
- 57.
C. Möllers, in: Krüper (Hg.), 2022, § 17 Rn. 3.
- 58.
Näher zur Rechtsprechungsorientierung der Staatsrechtslehre Schulze-Fielitz, in: ders., 2. Aufl. 2022, S. 3 (16 ff.).
- 59.
C. Schönberger, Der „German Approach“, 2015, S. 28 ff.; allgemein zum historisch jungen Phänomen der Rechtsprechungsorientierung der Rechtswissenschaft Jansen, Recht und gesellschaftliche Differenzierung, 2019, S. 297 ff.
- 60.
Schlink, Der Staat 28 (1989), S. 161 (163).
- 61.
So Gusy, in: Cancik u. a. (Hg.), 2022, S. 585 (603).
- 62.
Diese Beobachtung verdanke ich Klaus Ferdinand Gärditz.
- 63.
Allgemein zur Literaturgeschichte der bundesrepublikanischen Verfassungsrechtswissenschaft Pauly, in: Willoweit (Hg.), 2007, S. 883–933.
- 64.
Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 4, 2012, S. 136 ff.
- 65.
Ebd., S. 541 ff.
- 66.
Für eine Würdigung siehe Rückert, ZRG GA 136 (2019), S. 387–395.
- 67.
Bäumlin/Azzola (Hg.), Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 2 Bd., 1984.
- 68.
Maunz, Deutsches Staatsrecht, 1951.
- 69.
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1967.
- 70.
Pieroth/Schlink, Grundrechte – Staatsrecht II, 1985; ein Vergleich zwischen den drei Lehrbüchern bei Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (301 ff.).
- 71.
Siehe nur Degenhart, Staatszielbestimmungen, Staatsorgane, Staatsfunktionen, 1984; Badura, Staatsrecht, 1986; Ipsen, Staatsorganisationsrecht, 1986; Maurer, Staatsrecht I, 1999; Manssen, Staatsrecht II, 2000; Hufen, Staatsrecht II, 2007; Gröpl, Staatsrecht I, 2008.
- 72.
Jestaedt, Die Verfassung hinter der Verfassung, 2009, S. 37.
- 73.
Lennartz, in: Heinig/Schorkopf (Hg.), 2019, S. 67 (68).
- 74.
Näher zu dieser disziplinären Matrix Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (316 ff. m. w. N.).
- 75.
Jestaedt, in: ders. u. a., 2011, S. 77 (129 ff.).
- 76.
Gärditz, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 4, Rn. 102: „epistemische Gemeinschaft“. Zum Konzept der epistemischen Gemeinschaft Duve, Rg 29 (2021), S. 41 (50 ff.).
- 77.
Mangold/Payandeh (Hg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, 2022.
- 78.
Siehe nur Baer/Markard, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 7. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 2 und 3, Rn. 366 ff., 418 ff.; Mangold, Demokratische Inklusion durch Recht, 2021, § 5; Mangold/Payandeh, in: dies. (Hg.), 2022, § 1 Rn. 98 ff.
- 79.
BVerfGE 160, 79 (112 ff.) [2021] – Benachteiligungsrisiken von Menschen mit Behinderung in der Triage.
- 80.
Plebuch, in: Löhnig (Hg.), 2021, S. 283 (311 ff. m. w. N.).
- 81.
Suhr, Entfaltung des Menschen durch die Menschen, 1976, S. 25.
- 82.
Gärditz, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 4, Rn. 79 f., 159 f.; ders., AöR 148 (2023), S. 79 (80 ff.); zur Zeitgebundenheit der Grundrechtsdogmatik auch Kingreen, Der Staat 59 (2020), S. 195 (216 ff.). Allgemein zum Historizitätsdefizit von Dogmatik Jansen, JZ 2023, S. 573–581.
- 83.
Eifert, in: Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), 2012, S. 79 (86).
- 84.
Waechter, Die Verwaltung 29 (1996), S. 47–72.
- 85.
Dazu Heinig, in: Meinel (Hg.), 2018, S. 187 (193 ff.).
- 86.
Zur Ausblendung der politischen Dimension des Verfassungsrechts durch Dogmatik nur Volkmann, JZ 2020, S. 965 (971 f.).
- 87.
Dazu nur Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, 2013, S. 22 ff., 41 ff., 50 ff.
- 88.
Näher beschrieben bei Jestaedt, in: Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), 2012, S. 117 (125 f.); Lepsius, JZ 2019, S. 793 (794 ff.).
- 89.
Brohm, in: Geis (Hg.), 2001, S. 1079 (1081).
- 90.
Siehe nur Schaal, Integration durch Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, 2000; Vorländer (Hg.), Integration durch Verfassung, 2002; ders., (Hg.), Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, 2006; Brodocz, Die symbolische Dimension der Verfassung, 2003; van Ooyen, Der Begriff des Politischen des Bundesverfassungsgerichts, 2005; Lembcke, Hüter der Verfassung, 2007; Kneip, Verfassungsgerichte als demokratische Akteure, 2009. Zusammenfassend zu den Erträgen der politikwissenschaftlichen Bundesverfassungsgerichtsforschung Voigt in diesem Band.
- 91.
Böckenförde, in: ders., 2011, S. 156–188; ders., in: ebd., S. 120–155.
- 92.
Hacke, Philosophie der Bürgerlichkeit, 2. Aufl. 2008.
- 93.
Marquard, in: ders., 2. Aufl. 2015, S. 247–260.
- 94.
Zum Kontingenzbegriff Luhmann, in: ders., 2. Aufl. 2006, S. 93 (96).
- 95.
Meinel, in: Görres-Gesellschaft (Hg.), Staatslexikon, Bd. 2, 8. Aufl. 2018, Sp. 251–254.
- 96.
Vgl. nur Rawls, Political Liberalism, 2005, bes. S. 223 ff.; Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2. Aufl. 2017, S. 80 ff.; Fukuyama, Liberalism and its Discontents, 2022, S. 1 ff.; Özmen, Was ist Liberalismus?, 2023, S. 43 ff.
- 97.
Auf den Liberalismus bezogen bei C. Möllers, Freiheitsgrade, 2020, Ziff. 7.
- 98.
Zur demokratischen Fragwürdigkeit der Kategorie der Bürgerlichkeit C. Möllers, Merkur 2017, Heft 818, S. 5–16.
- 99.
Die Ordnungsvorstellung des Liberaletatismus wird in der Literatur überwiegend mit Ernst-Wolfgang Böckenförde in Verbindung gebracht, siehe vor allem C. Schönberger, in: H.-J. Große Kracht/K. Große Kracht (Hg.), 2014, S. 121–136. Böckenförde steht allerdings nur für eine bestimmte Konzeption des Liberaletatismus, nicht für die Ordnungsvorstellung im Ganzen.
- 100.
Di Fabio, Die Staatsrechtslehre und der Staat, 2003, S. 7.
- 101.
Böckenförde, in: ders., 1999, S. 127 (136).
- 102.
Isensee, in: ders./Kirchhof (Hg.), HdbStR I, 1987, § 13.
- 103.
Kirchhof, Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit, 2004.
- 104.
Pointiert Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, 2. Aufl. 1971, S. 21: „Die freiheitsstiftende rechtsstaatliche Verfassung steht und fällt mit der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft.“ Siehe ferner etwa Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, 1968, S. 149 ff.; Böckenförde, in: ders., 2006, S. 209–243; Kirchhof, Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit, 2004, S. 86 ff.
- 105.
Voßkuhle/Wischmeyer, Die Verfassung der Mitte, 2016 (Zitate S. 27, 48).
- 106.
Zur Unterscheidung von Konzept und Konzeption nur Poscher, in: Hage/von der Pfordten (Hg.), Concepts in Law, 2009, S. 99 (100 f.).
- 107.
Um konkret zu werden: Unter dem Dach des Liberaletatismus haben sich in ihren konkreten (partei-)politischen Affinitäten so unterschiedliche Verfassungsrechtler wie Peter Badura, Hartmut Bauer, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Christoph Degenhart, Udo di Fabio, Horst Dreier, Georg Hermes, Wolfram Höfling, Peter M. Huber, Friedhelm Hufen, Jörn Ipsen, Josef Isensee, Hans D. Jarass, Ferdinand und Paul Kirchhof, Hans Hugo Klein, Michael Kloepfer, Martin Kriele, Detlef Merten, Lerke Osterloh, Hans-Jürgen Papier, Bodo Pieroth, Gerhard Robbers, Michael Sachs, Bernhard Schlink, Helmuth Schulze-Fielitz, Karl-Peter Sommermann, Klaus Stern, Rainer Wahl und Joachim Wieland versammelt.
- 108.
Isensee, in: ders./Kirchhof (Hg.), HdbStR V, 1992, § 111.
- 109.
Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HdbStR I, 1987, § 22.
- 110.
Volkmann, AöR 134 (2009), S. 157–196.
- 111.
Eingehend zu den hier nicht näher betrachteten Auswirkungen des liberaletatistischen Leitbilds auf die Rechtsprechung zur Versammlungsfreiheit Helleberg, Leitbildorientierte Verfassungsauslegung, 2016, bes. S. 89 ff.
- 112.
BVerfGE 7, 198 [1958] – Lüth.
- 113.
Dazu statt vieler Dreier, in: ders., 2014, S. 185–248.
- 114.
Häberle, VVDStRL 30 (1972), S. 43 (80).
- 115.
BVerfGE 33, 303 (333) [1972] – Numerus clausus I.
- 116.
BVerfGE 50, 290 (337) [1979] – Mitbestimmung.
- 117.
So Dreier, in: ders., GG, 3. Aufl. 2013, Vorb. vor Art. 1 GG, Rn. 84; gleichsinnig Gärditz, Hochschulorganisation und verwaltungsrechtliche Systembildung, 2009, S. 283 ff.
- 118.
BVerfGE 158, 1 (33) [2021] – Ökotox-Daten; eine quasi-authentische Entscheidungsinterpretation bei Huber, EuR 57 (2022), S. 145 (151 ff.).
- 119.
Berlin, in: ders., 2006, S. 197 (201 ff.).
- 120.
Näher Özmen, Was ist Liberalismus?, 2023, S. 55 ff.
- 121.
Di Fabio, Das Recht offener Staaten, 1998 (Zitate S. 85, 89).
- 122.
Schlink, EuGRZ 1984, S. 457–468.
- 123.
Poscher, Grundrechte als Abwehrrechte, 2003.
- 124.
Mit Nuancen: Ruffert, Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts, 2001; Cremer, Freiheitsgrundrechte, 2003; Lindner, Theorie der Grundrechtsdogmatik, 2005.
- 125.
Grimm, in: ders., 1991, S. 67–100; dazu auch Augsberg, Theorien der Grund- und Menschenrechte, 2021, § 2.
- 126.
Grimm, in: ders., 1991, S. 221–240; siehe ferner noch Vesting, in: Grabenwarter u. a. (Hg.), 1994, S. 9–24.
- 127.
Rennert, Der Staat 53 (2014), S. 31–59.
- 128.
Näher und m. w. N. Bumke, AöR 144 (2019), S. 1 (57 ff.).
- 129.
Isensee, in: ders./Kirchhof (Hg.), HdbStR V, 1992, § 111, Rn. 83 ff.
- 130.
Rennert, Der Staat 53 (2014), S. 31 (50).
- 131.
Näher und m. w. N. Dreier, in: ders., 2014, S. 185 (200 ff.).
- 132.
BVerfGE 157, 30 (110 ff.) [2021] – Klimaschutz; dazu die Analyse bei Lepsius, in: Dreier (Hg.), 2022, S. 37 (65 ff.).
- 133.
Dazu Kulick/Vasel in diesem Band.
- 134.
Siehe nur Starck, in: Bundesminister der Justiz (Hg.), 1990, S. 9 (20 ff.); Murswiek, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HdbStR V, 1992, § 112, Rn. 40 ff., 86 ff; Dreier, in: ders., GG, 3. Aufl. 2013, Vorb. vor Art. 1 GG, Rn. 81, 89 f.
- 135.
Für eine Unterscheidung negativer, reflexiver und sozialer Freiheit Honneth, Das Recht der Freiheit, 4. Aufl. 2021, S. 33 ff.
- 136.
BVerfGE 4, 7, (15 f.) [1954] – Investitionshilfe: „Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolierten souveränen Individuums; das Grundgesetz hat vielmehr die Spannung Individuum – Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden, ohne dabei deren Eigenwert anzutasten.“
- 137.
Suhr, Entfaltung des Menschen durch die Menschen, 1976, bes. §§ 5, 6.
- 138.
Heinig, Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit, 2008, S. 365 f.
- 139.
Kirchhof, Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit, 2004, S. 35.
- 140.
BVerfGE 125, 175 (223) [2010] – Hartz IV.
- 141.
C. Möllers, in: Jestaedt u. a., 2011, S. 281 (385).
- 142.
So Mangold, in: Kersten/Rixen/Vogel (Hg.), 2021, S. 73 (84).
- 143.
Dazu affirmativ di Fabio, Die Kultur der Freiheit, 2005, S. 107 ff.; kritisch Sacksofsky, JöR 67 (2019), S. 377 (384 f).
- 144.
Nachweise und Kritik bei Kingreen, in: Bonner Kommentar, GG, Aktualisierung Februar 2020, Art. 3, Rn. 350 ff.
- 145.
Siehe aber für die Religionsfreiheit Sacksofsky, VVDStRL 68 (2009), S. 20 ff.; für die Meinungsfreiheit Bredler/Markard, JZ 2021, S. 864–872.
- 146.
Osterloh, EuGRZ 2002, S. 309 (311).
- 147.
BVerfGE 90, 145 [1994] – Cannabis.
- 148.
Näher und m. w. N. Mast, in: Müller/Dittrich (Hg.), 2022, S. 329–358.
- 149.
Dazu van Ooyen in diesem Band.
- 150.
Sachs, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HdbStR V, 1992, § 126, Rn. 29 ff., 88 ff.
- 151.
Sacksofsky, Das Grundrecht auf Gleichberechtigung, 1991.
- 152.
Baer, Würde oder Gleichheit, 1995.
- 153.
BVerfGE 85, 191 [1992] – Nachtarbeitsverbot.
- 154.
Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HdbStR I, 1987, § 22, Rn. 11 ff.
- 155.
BVerfGE 83, 37 [1990] – Ausländerwahlrecht I; BVerfGE 83, 60 [1990] – Ausländerwahlrecht II; BVerfGE 89, 155 [1993] – Maastricht; BVerfGE 93, 37 [1995] – Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein.
- 156.
C. Schönberger, in: H.-J. Große Kracht/K. Große Kracht (Hg.), 2014, S. 121 (133).
- 157.
Aus französischer Perspektive Jouanjan, Der Staat 58 (2019), S. 223–241; aus schweizerischer Perspektive Kley, VVDStRL 77 (2018), S. 125–160.
- 158.
Dreier, in: ders., 2014, S. 159 (161).
- 159.
Insbesondere Ridder, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, 1975, S. 35 ff. Zu Ridders Demokratieverständnis als Gegenentwurf zum Legitimationskettenmodell Preuß, in: Feichtner/Wihl (Hg.), Gesamtverfassung, 2022, S. 65–85. Eingehende Rekonstruktion der damaligen Diskurslandschaft bei Neumann, Volkswille, S. 345 ff.
- 160.
Zu monistischen versus pluralistischen Legitimationskonzepten etwa Jestaedt, in: Heinig/Terhechte (Hg.), 2013, S. 3 (9 ff.).
- 161.
Zu den Implikationen Plebuch/Pielhoff, Der Staat 61 (2022), S. 167 (177 ff.).
- 162.
Dazu kritisch C. Möllers, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 5, Rn. 100.
- 163.
BVerfGE 69, 315 [1985] – Brokdorf.
- 164.
Lepsius, in: Doering-Manteuffel/Greiner/Lepsius, 2015, S. 113 (142 ff.).
- 165.
Neben Bryde, StWStP 5 (1994), S. 305–330 vor allem die Beiträge in: Redaktion Kritische Justiz (Hg.), 2000.
- 166.
Eingehend Kuhn, Bundesverfassungsgericht und Parlamentarismus, 2021, S. 219 ff.
- 167.
BVerfGE 67, 100 [1984] – Flick-Untersuchungsausschuss.
- 168.
BVerfGE 68, 1 [1984] – Pershing II-Stationierung.
- 169.
BVerfGE 67, 100 (139) [1984] – Flick-Untersuchungsausschuss. Zur Kritik an dieser Argumentationsfigur Cancik, ZfP 45 (2014), S. 885–907.
- 170.
BVerfGE 68, 1 (86) [1984] – Pershing II-Stationierung.
- 171.
BVerfGE 104, 151 [2001] – NATO-Konzept.
- 172.
BVerfGE 137, 185 [2014] – Rüstungsexport.
- 173.
BVerfGE 143, 101 [2016] – NSA-Untersuchungsausschuss.
- 174.
Näher analysiert bei C. Möllers, Gewaltengliederung, 2005, S. 362 ff.; Kulick/Vasel in diesem Band. Zur Problemstellung insgesamt Ley, AöR 146 (2021), S. 299–352.
- 175.
Überblick etwa bei Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20, Rn. 267 ff.
- 176.
Zur demokratischen Problematik der Vertrauensschutzrechtsprechung Hohnerlein, Recht und demokratische Reversibilität, 2020, § 5.
- 177.
Zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Sozialstaat M. H. W. Möllers in diesem Band.
- 178.
Zu den Gründen Meinel, Merkur 2017, Heft 817, S. 35–46.
- 179.
BVerfGE 138, 136 [2014] – Erbschaftsteuer III.
- 180.
BVerfGE 138, 136 (252, 254) [2014] – Erbschaftsteuer III, Abweichende Meinung der Richter Gaier und Masing und der Richterin Baer.
- 181.
BVerfGE 89, 155 [1993] – Maastricht.
- 182.
BVerfGE 123, 267 [2009] – Lissabon.
- 183.
Näher zur europaverfassungsrechtlichen Rechtsprechung Lhotta/Ketelhut in diesem Band.
- 184.
Dazu kritisch van Ooyen in diesem Band.
- 185.
So mit Recht Voßkuhle, in: ders./Bumke/Meinel (Hg.), 2013, S. 371 (378).
- 186.
BVerfGE 126, 286 [2010] – Honeywell.
- 187.
Huber, Warum der EuGH Kontrolle braucht, 2022.
- 188.
Siehe nur BVerfGE 133, 277 (313 ff.) [2013] – Antiterrordateigesetz; BVerfGE 142, 123 [2016] – OMT-Programm der EZB; BVerfGE 154, 17 [2020] – PSPP-Programm der EZB.
- 189.
BVerfGE 152, 152 [2019] – Recht auf Vergessen I; BVerfGE 152, 216 [2019] – Recht auf Vergessen II.
- 190.
Ähnliche Einschätzung bei Kämmerer/Kotzur, NVwZ 2020, S. 177–184; Thym, JZ 2020, S. 1017–1027.
- 191.
BVerfGE 158, 1 (36) [2021] – Ökotox-Daten: „Auch die Auslegung der Charta der Grundrechte ist an der Europäischen Menschenrechtskonvention und den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten in Gestalt ihrer höchstrichterlichen Konkretisierung auszurichten.“ Dazu Hwang, Der Staat 62 (2023), S. 1 (8 f., 15, 25).
- 192.
Dazu auch Bull in diesem Band.
- 193.
Näher und m. w. N. Bäcker, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 28, Rn. 1 ff., 81 ff., 145 ff.
- 194.
Markanteste Ausnahme: Lindner/Unterreitmeier, DÖV 2017, S. 90–98.
- 195.
So Masing, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 15, Rn. 152 mit Fn. 163.
- 196.
Volkmann, JZ 2020, S. 965 (968 f., 972 f.); Gärditz, GSZ 2022, S. 161 (169 f.).
- 197.
BVerfG, NJW 2022, 1583.
- 198.
Zum daraus erwachsenden Spannungsverhältnis zur Egalität des demokratischen Prozesses Gärditz/Linzbach, GSZ 2023, S. 140 (146).
- 199.
BVerfGE 120, 224 [2008] – Geschwisterbeischlaf: „Die Wurzeln des Inzestverbots reichen zurück bis in das Altertum.“
- 200.
Zum Trend der Strafrechtsausweitung Hilgendorf, in: ders./Weitzel (Hg.), 2007, S. 191–215; zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf dem Gebiet des Strafrechts Heinrich in diesem Band; zu den Gründen für dessen Zurückhaltung Gärditz, in: Bäcker/Burchard (Hg.), 2022, S. 15–51.
- 201.
BVerfGE 7, 155 (162) [1957] – Hauptamtlicher Bürgermeister.
- 202.
Siehe nur Isensee, Gemeinwohl und öffentliches Amt, 2014, bes. S. 141 ff.
- 203.
Näher und m. w. N. Blackstein/Diesterhöft, in: Müller/Dittrich (Hg.), 2022, S. 153–201; Bull in diesem Band.
- 204.
BVerfGE 148, 296 [2018] – Streikverbot.
- 205.
Voßkuhle, in: Wahl (Hg.), 2010, S. 471 (487).
- 206.
Blackstein/Diesterhöft, in: Müller/Dittrich (Hg.), 2022, S. 153 (171).
- 207.
Sunstein, Harvard Law Review 108 (1995), S. 1733–1772.
- 208.
Näher analysiert bei Plebuch, Verfassungsblog v. 17.10.2022, https://verfassungsblog.de/rechtsfiguren-als-politische-waffen/ (letzter Abruf 27.06.2023). Siehe auch Balkin, The Cycles of Constitutional Time, 2020, S. 125 f.
- 209.
Zur Ritter-Schule als einer „Normalphilosophie“ der Bundesrepublik Ottmann, Akademie Aktuell 02/2015, S. 42 (44); differenzierend Schweda, Joachim Ritter und die Ritter-Schule zur Einführung, 2015, S. 185 ff.
- 210.
Conze, Die Suche nach Sicherheit, 2009.
- 211.
Fest, in: ders., 1993, S. 83–13.
- 212.
Kurbjuweit, Der Spiegel v. 11.03.2023, S. 30 (31).
- 213.
Münkler, Die Entstehung der Mitte, in: Schöneck/Ritter (Hg.), 2018, S. 29 (36).
- 214.
Dazu Schomäcker in diesem Band.
- 215.
Zur Kritik an diesen Konzepten m. w. N. Kischel, AöR 124 (1999), S. 174–211; Dann, Der Staat 49 (2010), S. 630–646; Lepsius, in: Jestaedt u. a., 2011, S. 159 (247 ff.); Payandeh, AöR 136 (2011), S. 578–615; Grzeszick, VVDStRL 71 (2012), S. 49–81.
- 216.
Zu den historischen Verdiensten des Bundesverfassungsgerichts nur Masing, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 15, Rn. 2 ff., 136 ff.; Grimm, Die Historiker und die Verfassung, 2022, bes. S. 137 ff., 165 ff; Bryde in diesem Band.
- 217.
Böckenförde, Der Staat 29 (1990), S. 1 (25).
- 218.
BVerfGE 93, 121 (152) [1995] – Einheitswerte II, Abweichende Meinung des Richters Böckenförde.
- 219.
In der deutschen Staatsrechtslehre war es vor allem Christoph Schönberger, der diese Fragen gestellt hat, siehe nur C. Schönberger, in: Jestaedt u. a., 2011, S. 9 (40 ff.); ders., in: Vesting/Korioth (Hg.), 2011, S. 7 (20 f.); ders., JöR 63 (2015), S. 41–62.
- 220.
Volkmann, Der Staat 58 (2019), S. 643–658.
- 221.
Huber, Der Staat 56 (2017), S. 389–414; Baer, Journal of the British Academy 8 (2020), S. 75–104; Voßkuhle, in: ders., 2021, S. 344–363.
- 222.
Näher und m. w. N. Grimm, in: ders., 2021, S. 357–398.
- 223.
Heitmeyer, in: Möller (Hg.), 2022, S. 300–328.
- 224.
Zur Unverzichtbarkeit von Verfassungsgerichten bei der Bewältigung politischer Systemkrisen Issacharoff, Fragile Democracies, 2015.
- 225.
Neben der Rechtsprechung zu den Äußerungsrechten politischer Amtsträger sind etwa zu nennen: BVerfG, NJW 2023, 672 (Anhebung der absoluten Obergrenze für staatliche Parteienfinanzierung); NJW 2023, S. 831 (staatliche Förderung politischer Stiftungen); NJW 2023, S. 2561 (Gesetzgebungsverfahren zum Gebäudeenergiegesetz).
- 226.
Vgl. für das Parlamentsrecht Meinel, Merkur 2021, Heft 869, S. 53–59; Jung, JöR 71 (2023), S. 21–56.
- 227.
Taylor, in: ders., 1992, S. 118 (118).
- 228.
Zur Problemstellung etwa Kersten, Die Notwendigkeit der Zuspitzung, 2020, S. 64 ff.
- 229.
Heidenreich, Nachhaltigkeit und Demokratie, 2023, S. 95 ff.
- 230.
BVerfGE 157, 30 [2021] – Klimaschutz.
- 231.
Näher analysiert bei C. Möllers/Weinberg, JZ 2021, S. 1069–1078.
- 232.
Von Redecker, Bleibefreiheit, 2023, S. 14.
- 233.
EuGH (Sechste Kammer), Urteil vom 25.03.2021 – C-565/19 P (ECLI:EU:C:2021:252).
- 234.
C. Möllers, Freiheitsgrade, 2020, Ziff. 34.
- 235.
Zur Problemstellung nur Muckel, VVDStRL 79 (2020), S. 245–289; S. Schönberger, ebd., S. 291–318.
- 236.
BVerfGE 148, 267 [2018] – Stadionverbot.
- 237.
Michl, JZ 2018, S. 910–918.
- 238.
Näher Buchheim, in: Müller/Dittrich (Hg.), 2022, S. 3–47.
- 239.
Näher Masing, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 15, Rn. 163 ff.
- 240.
Vgl. Meinel, Der Staat 60 (2021), S. 43–98.
- 241.
BVerfGE 138, 102 [2014] – Schwesig; BVerfGE 148, 11 [2018] – Wanka; BVerfGE 154, 320 [2020] – Seehofer; BVerfG, NVwZ 2022, 1113 – Merkel. Kritisiert wird u. a., dass das Bundesverfassungsgericht die Differenz von Regierung und Verwaltung, von Gubernative und Administrative systematisch dadurch einebnet, dass es die amtlichen Äußerungen von Regierungsmitgliedern – auch außerhalb von Wahlkampfzeiten und unabhängig von der Nutzung regierungsspezifischer Ressourcen – einem Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot unterstellt und dabei einen rationalistischen Politikbegriff bzw. ein expertokratisches Legitimationsmodell zu Grunde legt; siehe nur Payandeh, Der Staat 55 (2016), S. 519–550; Kuch, AöR 142 (2017), S. 491–527; Gusy, KritV (101) 2018, S. 210–235; Meinel, Der Staat 60 (2021), S. 43 (79 ff.); Honer, Die grundgesetzliche Theorie der Regierung, 2022, S. 319 ff; van Ooyen, RuP 58 (2022), S. 377–383.
- 242.
Näher und m. w. N. Frick, Die Staatsrechtslehre im Streit um ihren Gegenstand, 2018, S. 186 ff.
- 243.
Siehe nur Lepsius, in: Meinel (Hg.), 2019, S. 119–154; ders., JZ 2019, S. 793–802. Zum Kontextualisierungsansatz Hwang, Rechtstheorie 47 (2016), S. 165–182; Kingreen, Der Staat 59 (2020), S. 195 (222 ff.); Pielhoff, JöR 68 (2020), S. 241–270; Gärditz, in: Herdegen u. a. (Hg.), 2021, § 4, Rn. 63 f.
- 244.
BVerfGE 148, 296 [2018] – Streikverbot.
- 245.
Näher und m. w. N. Krüper, in: Funke/Krüper/Lüdemann (Hg.), 2015, S. 123–156; siehe auch Haltern in diesem Band.
- 246.
Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 1982.
- 247.
Dazu nur Lepsius, JZ 2005, S. 1–13; von Arnauld, in: Funke/Lüdemann (Hg.), 2009, S. 65–118.
- 248.
Engel, in: ders. (Hg.), 1998, S. 11–40; van Aaken, in: Eger u. a. (Hg.), 2008, S. 651–665; Towfigh, I.CON 12 (2014), S. 670–691; Magen, in: Funke/Krüper/Lüdemann (Hg.), 2015, S. 103–123; Petersen/Chatziathanasiou, AöR 144 (2019), S. 501–535; Ighreiz u. a., AöR 145 (2020), S. 537–613.
- 249.
Deneen, Why Liberalism Failed, 2018; Vermeule, Common Good Constitutionalism, 2022.
- 250.
Haack, AöR 136 (2011), S. 365–401; Schachtschneider, Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam, 2. Aufl. 2011; Murswiek, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hg.), 2016, S. 123–139; Vosgerau, Staatliche Gemeinschaft und Staatengemeinschaft, 2016, bes. § 8.
- 251.
Menke, Kritik der Rechte, 2015; Loick, Juridismus, 2017.
- 252.
Näher und m. w. N. Kutting, Die Normativitätsstruktur subjektiver Rechte, 2023, Kap. C III.
- 253.
Siehe nur Sacksofsky, JöR 67 (2019), S. 377 (398 ff.); Mangold, VVDStRL 80 (2021), S. 7 (bes. 11 f.).
- 254.
Siehe nur Sacksofsky, in: Kempny/Reimer (Hg.), 2017, S. 63–90; Röhner, Ungleichheit und Verfassung, 2019, S. 183 ff.; Mangold, Demokratische Inklusion durch Recht, 2021, S. 187 ff.
- 255.
Speziell dazu Mangold, in: Eckertz-Höfer/Schuler-Harms (Hg.), 2019, S. 109–124; Röhner, Ungleichheit und Verfassung, 2019, S. 183 ff.; Wapler, JöR 67 (2019), S. 427–455; Kersten, Die Notwendigkeit der Zuspitzung, 2020, S. 121 ff.; Valentiner, JöR 71 (2023), S. 209–227.
- 256.
Für eine kritische Diskussion dieser Ansätze siehe etwa Schorkopf, Staat und Diversität, 2017; Rixen, in: Eckertz-Höfer/Schuler-Harms (Hg.), 2019, S. 59–84; Froese, Der Mensch in der Wirklichkeit des Rechts, 2022, § 10; Volk, Paritätisches Wahlrecht, 2022, S. 109 ff., 240 ff.
- 257.
Siehe nur Classen, AöR 119 (1994), S. 238–260; Pernice, AöR 120 (1995), S. 100–120.
- 258.
So Meinel, Der Staat 60 (2021), S. 43 (44 f.).
- 259.
Günther, Denken vom Staat her, 2004.
- 260.
Näher und m. w. N. Frick, Die Staatsrechtslehre im Streit um ihren Gegenstand, 2018, S. 133 ff.
- 261.
Insbesondere Meinel, Der Staat 60 (2021), S. 43–98; siehe auch Neumeier, Kompetenzen, 2022, S. 381 ff. Zu den Spielarten des politischen Konstitutionalismus Bellamy, Political Constitutionalism, 2007, S. 145 ff.
- 262.
Hirschauer, Soziopolis v. 21.09.2020, https://www.soziopolis.de/ungehaltene-dialoge.html (letzter Abruf 27.06.2023).
- 263.
Sinnverwandte Zustandsbeschreibungen bei Schulze-Fielitz, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hg.), 2. Aufl. 2021, S. 353 (382); Gusy, in: Cancik u. a. (Hg.), 2022, S. 585 (604). Programmatisch von Arnauld, VVDStRL 74 (2015), S. 39 (41): „Rechtswissenschaft ist multiperspektivisch, und dieser Multiperspektivität entspricht ein Pluralismus der Methoden.“
- 264.
Etwa Dreier, in: ders. (Hg.), 2018, S. 1 (2 ff.).
- 265.
Vgl. Bianchi, International Law Theories, 2016, der dreizehn (!) z. T. binnenplurale Zugänge zum Völkerrecht unterscheidet.
Literatur
van Aaken, Anne, How to do Constitutional Law and Economics: A Methodological Proposal, in: Thomas Eger u. a. (Hg.), Internationalization of the Law and its Economic Analysis. Festschrift für Hans-Bernd Schäfer zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2008, S. 651–665.
von Arnauld, Andreas, Die Wissenschaft vom Öffentlichen Recht nach einer Öffnung für sozialwissenschaftliche Theorie, in: Andreas Funke/Jörn Lüdemann (Hg.), Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie, Tübingen 2009, S. 65–118.
von Arnauld, Andreas, Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch Internationalität und Interdisziplinarität: Erscheinungsformen, Chancen, Grenzen, VVDStRL 74 (2015), S. 39–87.
Augsberg, Ino, Demokratische Aufklärung. Dietrich Jeschs Neubestimmung der Verwaltungsrechtsdogmatik unter dem Grundgesetz, in: Carsten Kremer (Hg.), Die Verwaltungsrechtswissenschaft in der frühen Bundesrepublik (1949–1977), Tübingen 2017, S. 287–304.
Augsberg, Ino, Theorien der Grund- und Menschenrechte. Eine Einführung, Tübingen 2021.
Badura, Peter, Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, München 1986.
Bäcker, Carsten, Sicherheitsverfassungsrecht, in: Matthias Herdegen u. a. (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts. Darstellung in transnationaler Perspektive, München 2021, § 28.
Baer, Susanne, Würde oder Gleichheit – Zur angemessenen grundrechtlichen Konzeption von Recht gegen Diskriminierung am Beispiel sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland und den USA, Baden-Baden 1995.
Baer, Susanne, Who cares? A defence of judicial review, Journal of the British Academy 8 (2020), S. 75–104
Bäumlin, Richard/Azzola, Axel (Hg.), Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 2 Bd., Neuwied 1984.
Balkin, Jack, The Cycles of Constitutional Time, New York 2020.
Bellamy, Richard, Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge 2007.
Benda, Ernst/Maihofer, Werner/Vogel, Hans-Jochen, Vorwort, in: dies. (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin/New York 1984, S. V–VIII.
Berlin, Isaiah, Zwei Freiheitsbegriffe (1958), in: ders., Freiheit. Vier Versuche, Frankfurt am Main 2006, S. 197–256.
Bianchi, Andrea, International Law Theories. An Inquiry into Different Ways of Thinking, Oxford 2016.
Blackstein, Ylva/Diesterhöft, Martin, Warum braucht der Tiger Zähne? Das justiziable Alimentationsprinzip als Eckpfeiler des Berufsbeamtentums, in: Daniel Bernhard Müller/Lars Dittrich (Hg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 6, Berlin/Boston 2022, S. 153–201.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart (1972), in: ders., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Erweiterte Ausgabe, Frankfurt am Main 2006, S. 209–243.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation (1974), in: ders., Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht. Aufsätze von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Berlin 2011, S. 156–188.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Die Methoden der Verfassungsinterpretation – Bestandsaufnahmen und Kritik, in: ders., Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht. Aufsätze von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Berlin 2011, S. 120–155.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang (Hg.), Staat und Gesellschaft, Darmstadt 1976.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, Heidelberg 1987, § 22.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Grundrechte als Grundsatznormen, Der Staat 29 (1990), S. 1–31.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Begriffe und Probleme des Verfassungsstaats (1997), in: ders., Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main 1999, S. 127–140.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Verfassungsgerichtsbarkeit: Strukturfragen, Organisation, Legitimation, NJW 1999, S. 9–17.
Boulanger, Christian, Die Soziologie juristischer Wissensproduktion. Rechtsdogmatik als soziale Praxis, in: ders./Julika Rosenstock/Tobias Singelnstein (Hg.), Interdisziplinäre Rechtsforschung. Eine Einführung in die geistes- und sozialwissenschaftliche Befassung mit dem Recht und seiner Praxis, Wiesbaden 2019, S. 173–192.
Bredler, Eva Maria/Markard, Nora, Grundrechtsdogmatik der Beleidigungsdelikte im digitalen Raum. Ein gleichheitsrechtliches Update der Grundrechtsabwägung bei Hassrede, JZ 2021, S. 864–872.
Brodocz, André, Die symbolische Dimension der Verfassung. Ein Beitrag zur Institutionentheorie, Wiesbaden 2003.
Brohm, Winfried, Kurzlebigkeit und Langzeitwirkung der Rechtsdogmatik, in: Max-Emanuel Geis (Hg.), Staat, Kirche, Verwaltung. Festschrift für Hartmut Maurer, München 2001, S. 1079–1090.
Brugger, Kommunitarismus als Verfassungstheorie des Grundgesetzes (1998), in: ders., Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes, Baden-Baden 1999, S. 253–284.
Bryde, Brun-Otto, Verfassungsentwicklung. Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepublik, Baden-Baden 1982.
Bryde, Brun-Otto, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, StWStP 5 (1994), S. 305–330.
Buchheim, Johannes, Rechtfertigungszentrierte Grundrechtslehren. Grundrechtsgeltung und Grundrechtswirkungen in der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Daniel Bernhard Müller/Lars Dittrich (Hg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 6, Berlin/Boston 2022, S. 3–47.
Bumke, Christian, Die Entwicklung der Grundrechtsdogmatik in der deutschen Staatsrechtslehre unter dem Grundgesetz, AöR 144 (2019), S. 1–80.
Cancik, Pascale, Der „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“ – zur Relativität eines suggestiven Topos, ZfP 45 (2014), S. 885–907.
Classen, Claus Dieter, Europäische Integration und demokratische Legitimation, AöR 119 (1994), S. 238–260.
Collings, Justin, Phasen der öffentlichen Kritik am Bundesverfassungsgericht, in: Florian Meinel (Hg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bonner Republik – Aspekte einer Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 2019, S. 63–79.
Conze, Eckart, Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, München 2009.
Cornils, Matthias, BVerfGE 123, 267 – Lissabon. Mitgliedstaatlichkeit vorbehalten: Europa am Endpunkt der Integration, in: Jörg Menzel/Ralf Müller-Terpitz (Hg.), Verfassungsrechtsprechung. Ausgewählte Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Retrospektive, 3. Aufl., Tübingen 2017, S. 852–863.
Cremer, Wolfram, Freiheitsgrundrechte. Funktionen und Strukturen, Tübingen 2003.
Dann, Philipp, Verfassungsgerichtliche Kontrolle gesetzgeberischer Rationalität, Der Staat 49 (2010), S. 630–646.
Degenhart, Christoph, Staatszielbestimmungen, Staatsorgane, Staatsfunktionen, Heidelberg 1984.
Deneen, Patrick J., Why Liberalism Failed, New Haven/London 2018.
Depenheuer, Otto, Grenzenlos gefährlich – Selbstermächtigungen des Bundesverfassungsgerichts, in: Christian Hillgruber (Hg.), Gouvernement des juges – Fluch oder Segen, Paderborn 2014, S. 79–117.
di Fabio, Udo, Das Recht offener Staaten. Grundlinien einer Staats- und Rechtstheorie, Tübingen 1998.
di Fabio, Udo, Die Staatsrechtslehre und der Staat, Paderborn 2003.
di Fabio, Udo, Die Kultur der Freiheit, München 2005.
Dreier, Dimensionen der Grundrechte. Von der Wertordnungsjudikatur zu den objektiv-rechtlichen Grundrechtsgehalten (1993), in: ders., Idee und Gestalt des freiheitlichen Verfassungsstaats, Tübingen 2014, S. 185–248.
Dreier, Horst, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes (1997), in: ders., Idee und Gestalt des freiheitlichen Verfassungsstaats, Tübingen 2014, S. 159–184.
Dreier, Horst (Hg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 3. Aufl., Tübingen 2013.
Dreier, Horst, Rechtswissenschaft als Wissenschaft – Zehn Thesen, in: ders. (Hg.), Rechtswissenschaft als Beruf, Tübingen 2018, S. 1–65.
Duve, Thomas, Rechtsgeschichte als Geschichte von Normativitätswissen?, Rg 29 (2021), S. 41–68.
Ebsen, Ingwer, Das Bundesverfassungsgericht als Element gesellschaftlicher Selbstregulierung. Eine pluralistische Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit im demokratischen Verfassungsstaat, Berlin 1985.
Eifert, Martin, Zum Verhältnis von Dogmatik und pluralisierter Wissenschaft, in: Gregor Kirchhof/Stefan Magen/Karsten Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik? Was leistet und wie steuert die Dogmatik des öffentlichen Rechts?, Tübingen 2012, S. 79–96.
Engel, Christoph, Rechtswissenschaft als angewandte Sozialwissenschaft. Die Aufgabe der Rechtswissenschaft nach der Öffnung der Rechtsordnung für sozialwissenschaftliche Theorie, in: ders. (Hg.), Methodische Zugänge zu einem Recht der Gemeinschaftsgüter, Baden-Baden 1998, S. 11–40.
Feichtner, Isabel/Wihl, Tim (Hg.), Gesamtverfassung. Das Verfassungsdenken Helmut Ridders, Baden-Baden 2022.
Felsch, Philipp, Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990, München 2015.
Fest, Joachim, Die zerbrechliche Ordnung, in: ders., Die schwierige Freiheit. Über die offene Flanke der offenen Gesellschaft, Berlin 1993, S. 83–113.
Forsthoff, Ernst, Der Staat der Industriegesellschaft. Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., München 1971.
Frick, Verena, Die Staatsrechtslehre im Streit um ihren Gegenstand. Die Staats- und Verfassungsdebatten seit 1979, Tübingen 2018.
Friedrich, Manfred (Hg.), Verfassung. Beiträge zur Verfassungstheorie, Darmstadt 1978.
Froese, Judith, Der Mensch in der Wirklichkeit des Rechts. Zur normativen Erfassung des Individuums durch Kategorien und Gruppen, Tübingen 2022.
Fukuyama, Francis, Liberalism and its Discontents, London 2022.
Gärditz, Klaus Ferdinand, Hochschulorganisation und verwaltungsrechtliche Systembildung, Tübingen 2009.
Gärditz, Klaus Ferdinand, Verfassungsentwicklung und Verfassungsrechtswissenschaft, in: Matthias Herdegen u. a. (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts. Darstellung in transnationaler Perspektive, München 2021, § 4.
Gärditz, Klaus Ferdinand, Demokratische Sonderstellung des Strafrechts, in: Matthias Bäcker/Christoph Burchard (Hg.), Strafverfassungsrecht, Tübingen 2022, S. 15–51.
Gärditz, Klaus Ferdinand, Verfassungsschutzverfassungsrecht und Datenübermittlung. Zugleich eine Besprechung von BVerfG, Urt. v. 26.04.2022 – 1 BvR 1619/17 = GSZ 2022, 2022, 137 ff., GSZ 2022, S. 161–170.
Gärditz, Klaus Ferdinand, Zukunftsverfassungsrecht, AöR 148 (2023), S. 79–114.
Gärditz, Klaus Ferdinand/Linzbach, Karoline Marie, Nachrichtendienstliche Quellen-Telekommunikationsüberwachung und gemeinsames nachrichtendienstliches Informationssystem im Verfassungsbeschwerdeverfahren, GSZ 2023, S. 140–146.
Grimm, Dieter (Hg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, 2 Bände, München 1976.
Grimm, Dieter, Verfassungsgerichtsbarkeit im demokratischen System (1976), in: ders., Verfassungsgerichtsbarkeit, Berlin 2021, S. 37–60.
Grimm, Dieter, Rückkehr zum liberalen Grundrechtsverständnis? (1988), in: ders., Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt am Main 1991, S. 221–240.
Grimm, Dieter, Die Grundrechte im Entstehungszusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft (1988), in: ders., Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt am Main 1991, S. 67–100.
Grimm, Dieter, Verfassung, Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassungsinterpretation an der Schnittstelle von Recht und Politik (2008), in: ders., Verfassungsgerichtsbarkeit, Berlin 2021, S. 153–171.
Grimm, Dieter Was ist politisch an der Verfassungsgerichtsbarkeit? (2019), in: ders., Verfassungsgerichtsbarkeit, Berlin 2021, S. 89–104.
Grimm, Dieter, Neue Radikalkritik an der Verfassungsgerichtsbarkeit (2020), in: ders., Verfassungsgerichtsbarkeit, Berlin 2021, S. 357–398.
Grimm, Dieter, Interview mit Alec Stone Sweet und Giacinto della Cananea, German Law Journal (GLJ) 22 (2021), S. 1541–1554.
Grimm, Dieter, Die Historiker und die Verfassung. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes, München 2022.
Gröpl, Christoph, Staatsrecht I. Staatsgrundlagen, Staatsorganisation, Verfassungsprozess, München 2008.
Grzeszick, Bernd, Rationalitätsanforderungen an die parlamentarische Rechtsetzung im demokratischen Rechtsstaat, VVDStRL 71 (2012), S. 49–81.
Günther, Frieder, Denken vom Staat her. Die bundesdeutsche Staatsrechtslehre zwischen Dezision und Integration 1949–1970, München 2004.
Gusy, Christoph, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, Berlin 1985.
Gusy, Christoph, Parlamentarische oder „neutrale“ Regierung? Eine Anfrage, KritV (101) 2018, S. 210–235.
Gusy, Christoph, Asymmetrische Dialoge. Verfassungsgerichtsbarkeit als Themenstellung, in: Pascale Cancik u. a. (Hg.), Streitsache Staat. Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 1922–2022, Tübingen 2022, S. 585–605.
Haack, Stefan, Verfassungshorizont und Taburaum, AöR 136 (2011), S. 365–401.
Hacke, Jens, Philosophie der Bürgerlichkeit. Die liberalkonservative Begründung der Bundesrepublik, 2. Aufl., Göttingen 2008.
Häberle, Peter, Grundrechte im Leistungsstaat, VVDStRL 30 (1972), S. 43–141.
Häberle, Peter (Hg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, Darmstadt 1976.
Häberle, Peter, Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Politik und Rechtswissenschaft (1979), in: ders., Verfassungsgerichtsbarkeit – Verfassungsprozessrecht. Ausgewählte Beiträge aus vier Jahrzehnten, Berlin 2014, S. 49–70.
Häberle, Peter, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlin 1982.
Hain, Karl-E., Systematische Rekonstruktion des Verfassungsrechts als Aufgabe der Verfassungsrechtsdogmatik, in: Christian Starck (Hg.), Die Rolle der Verfassungsrechtswissenschaft im demokratischen Verfassungsstaat. Zweites deutsch-taiwanesisches Kolloquium vom 26. bis. 28. September 2002 in Taipeh, Baden-Baden 2004, S. 45–56.
Haltern, Ulrich, Verfassungsgerichtsbarkeit, Demokratie und Mißtrauen. Das Bundesverfassungsgericht in einer Verfassungstheorie zwischen Populismus und Progressivismus, Berlin 1998.
Heidenreich, Felix, Nachhaltigkeit und Demokratie. Eine politische Theorie, Berlin 2023.
Heinig, Hans Michael, Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit. Zur Formel vom „sozialen Staat“ in Art. 20 Abs. 1 GG, Tübingen 2008.
Heinig, Hans Michael, Das Bundesverfassungsgericht und seine (unmaßgebliche) Rolle für Deutungen und Entwicklungen im Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes bis zum Ende der 1960er Jahre, in: Florian Meinel (Hg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bonner Republik, Tübingen 2018, S. 187–198.
Heitmeyer, Wilhelm, Autoritärer Nationalradikalismus (2018), in: Kolja Möller (Hg.), Populismus. Ein Reader, Berlin 2022, S. 300–328.
Helleberg, Max, Leitbildorientierte Verfassungsauslegung. Bestandsaufnahme und Kritik unter besonderer Würdigung der Versammlungsfreiheit, Berlin 2016.
Hesse, Konrad, Die normative Kraft der Verfassung (1959), in: Julian Krüper/Mehrdad Payandeh/Heiko Sauer (Hg.), Konrad Hesses normative Kraft der Verfassung, Tübingen 2019, S. 1–18.
Hesse, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Karlsruhe 1967.
Heun, Werner, Funktionell-rechtliche Schranken der Verfassungsgerichtsbarkeit – Reichweite und Grenzen einer dogmatischen Argumentationsfigur, Baden-Baden 1992.
Hilbert, Patrick, Systemdenken in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft, Tübingen 2015.
Hilgendorf, Eric, Beobachtungen zur Entwicklung des deutschen Strafrechts 1975–2005, in: ders./Jürgen Weitzel (Hg.), Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, Berlin 2007, S. 191–215.
Hirschauer, Stefan, Ungehaltene Dialoge. Zur Fortentwicklung soziologischer Intradisziplinarität, Soziopolis v. 21.09.2020, https://www.soziopolis.de/ungehaltene-dialoge.html (letzter Abruf 27.06.2023).
Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hg.), Sozialwissenschaften im Studium des Rechts, Bd. II: Verfassungs- und Verwaltungsrecht, München 1977.
Hohnerlein, Jakob, Recht und demokratische Reversibilität. Verfassungstheoretische Legitimation und verfassungsdogmatische Grenzen der Bindung demokratischer Mehrheiten an erschwert änderbares Recht, Tübingen 2020.
Honer, Mathias, Die grundgesetzliche Theorie der Regierung. Zugleich ein Beitrag zur Rechtsgewinnung im Verfassungsrecht, Tübingen 2022.
Honneth, Alex, Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit, 4. Aufl., Berlin 2021.
Huber, Peter Michael, Europäische Verfassungs- und Rechtsstaatlichkeit in Bedrängnis. Zur Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa, Der Staat 56 (2017), S. 389–414.
Huber, Peter Michael, Die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten. Identifizierung und Konkretisierung, EuR 57 (2022), S. 145–164.
Huber, Peter Michael, Warum der EuGH Kontrolle braucht, Wien 2022.
Huber, Peter Michael, Der Erfolg des Bundesverfassungsgerichts, FAZ v. 06.04.2023, S. 8.
Hufen, Friedhelm, Staatsrecht II. Grundrechte, München 2007.
Huster, Stefan, Die ethische Neutralität des Staates. Eine liberale Interpretation der Verfassung, 2. Aufl., Tübingen 2017.
Hwang, Shu-Perng, Überlegungen zum Materialisierungsansatz des BVerfG im Verhältnis zwischen Recht und Politik (2015), in: dies., Verfassungsordnung als Rahmenordnung. Eine kritische Untersuchung zum Materialisierungsansatz aus rahmenorientierter Perspektive, Tübingen 2018, S. 177–201.
Hwang, Shu-Perng, Kontextualisierung statt Rechtsanwendung? Überlegungen zur aktuellen Debatte um die Verfassungsgerichtsbarkeit aus der Sicht der Reinen Rechtslehre, Rechtstheorie 47 (2016), S. 165–182.
Hwang, Shu-Perng, Von der Abgrenzung zur Vereinheitlichung: auf dem Weg zu einem funktionsfähigen Grundrechtsverbund? Überlegungen zur neueren Rechtsprechung des BVerfG zum Grundrechtsschutz im europäischen Mehrebenensystem, Der Staat 62 (2023), S. 1–26.
Ighreiz, Ali u. a., Karlsruher Kanones? Selbst- und Fremdkanonisierung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 145 (2020), S. 537–613.
Ipsen, Jörn, Staatsorganisationsrecht, Frankfurt am Main 1986.
Isensee, Josef, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht. Eine Studie über das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, Berlin 1968.
Isensee, Josef, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: ders./Paul Kirchhof (Hg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 5, Heidelberg 1992, § 111.
Isensee, Josef, Gemeinwohl und öffentliches Amt. Vordemokratische Fundamente des Verfassungsstaates, Wiesbaden 2014.
Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 7 Bd., Heidelberg, ab 1987.
Issacharoff, Samuel, Fragile Democracies. Contested Power in the Era of Constitutional Courts, New York 2015.
Jansen, Nils, Recht und gesellschaftliche Differenzierung. Fünf Studien zur Genese des Rechts und seiner Wissenschaft, Tübingen 2019.
Jansen, Nils, Kanonisierungs- und Dogmatisierungsprozesse in Recht und Religion. Historisch-vergleichende Beobachtungen, in: Ino Augsberg/Gunnar Folke Schuppert (Hg.), Wissen und Recht, Baden-Baden 2022, S. 487–505.
Jansen, Nils, Zeit, Sprache und dogmatische Jurisprudenz, JZ 2023, S. 573–581.
Jesch, Dietrich, Gesetz und Verwaltung – Eine Problemstudie zum Wandel des Gesetzmäßigkeitsprinzips, Tübingen 1961.
Jestaedt, Matthias, Die Verfassung hinter der Verfassung. Eine Standortbestimmung der Verfassungstheorie, Paderborn 2009.
Jestaedt, Matthias, Phänomen Bundesverfassungsgericht – Was das Gericht zu dem macht, was es ist, in: ders. u. a., Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin 2011, S. 77–157.
Jestaedt, Matthias, Zur Kopplung von Politik und Recht in der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Thomas Vesting/Stefan Korioth (Hg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts. Was bleibt von der Verfassung nach der Globalisierung?, Tübingen 2011, S. 317–332.
Jestaedt, Matthias, Wissenschaftliches Recht – Rechtsdogmatik als gemeinsames Kommunikationsformat von Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, in: Gregor Kirchhof/Stefan Magen/Karsten Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik? Was leistet und wie steuert die Dogmatik des öffentlichen Rechts?, Tübingen 2012, S. 117–137.
Jestaedt, Matthias, Radien der Demokratie: Volksherrschaft, Betroffenheitspartizipation oder plurale Legitimation?, in: Hans Michael Heinig/Jörg Philipp Terhechte (Hg.), Postnationale Demokratie, Postdemokratie, Neoetatismus. Wandel klassischer Demokratievorstellungen in der Rechtswissenschaft, Tübingen 2013, S. 3–18.
Jouanjan, Olivier, Demokratietheorie als Verfassungslehre, Der Staat 58 (2019), S. 223–241.
Jung, Laura, Parlamentarische Obstruktion und Selbstschutz des Parlaments, JöR 71 (2023), S. 21–56.
Kämmerer, Jörn Axel/Kotzur, Markus, Vollendung des Grundrechtsverbundes oder Heimholung des Grundrechtsschutzes? Die BVerfG-Beschlüsse zum „Recht auf Vergessen“ als Fanal, NVwZ 2020, S. 177–184.
Kaiser, Roman/Wolff, Daniel, „Verfassungshütung“ im Commonwealth als Vorbild für den deutschen Verfassungsstaat? Zugleich ein Beitrag zur Legitimation verfassungsgerichtlicher Normenkontrollrechte, Der Staat 56 (2017), S. 39–76.
Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, Studienausgabe der 2. Auflage 1960 (herausgegeben von Matthias Jestaedt), Tübingen 2017.
Kersten, Jens, Die Notwendigkeit der Zuspitzung. Anmerkungen zur Verfassungstheorie, Berlin 2020.
Kingreen, Thorsten, Das gute alte Grundgesetz und wir Nachkonstitutionellen, Der Staat 59 (2020), S. 195–226.
Kirchhof, Paul, Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit. Von Privileg und Überfluss zu einer Kultur des Maßes, Paderborn 2004.
Kischel, Uwe, Systembindung des Gesetzgebers, AöR 124 (1999), S. 174–211
Kley, Andreas, Kontexte der Demokratie: Herrschaftsausübung in Arbeitsteilung, VVDStRL 77 (2018), S. 125–160.
Kloepfer, Michael, Verfassungsausweitung und Verfassungsrechtswissenschaft, in: Bernd Rüthers/Klaus Stern (Hg.), Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat. Festgabe zum 10jährigen Jubiläum der Gesellschaft für Rechtspolitik, München 1984, S. 199–207.
Kneip, Sascha, Verfassungsgerichte als demokratische Akteure. Der Beitrag des Bundesverfassungsgerichts zur Qualität der bundesdeutschen Demokratie, Baden-Baden 2009.
Koenen, Gerd, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967–1977, Köln 2001.
Krüper, Julian, Die Verfassung der Berliner Republik. Verfassungsrecht und Verfassungsrechtswissenschaft in zeitgeschichtlicher Perspektive, Rechtsgeschichte – Legal History (Rg) 23 (2015), S. 16–51.
Krüper, Julian, Konjunktur kulturwissenschaftlicher Forschung in der Wissenschaft vom öffentlichen Recht, in: Funke/Krüper/Lüdemann (Hg.), Konjunkturen in der öffentlich-rechtlichen Grundlagenforschung, 2015, S. 123–156.
Kuch, David, Politische Neutralität in der Parteiendemokratie, AöR 142 (2017), S. 491–527.
Kuhn, Astrid, Bundesverfassungsgericht und Parlamentarismus. Entscheidungen seit 1975 im Spannungsfeld zwischen klassischem und parteiendemokratischem Verständnis, Baden-Baden 2021.
Kurbjuweit, Dirk, Die Kontrollfreaks, Der Spiegel v. 11.03.2023, S. 30–31.
Kutting, Isabelle M., Die Normativitätsstruktur subjektiver Rechte. Eine rechtsdogmatische Untersuchung ausgehend von Menkes Kritik der Rechte, Berlin 2023.
von Landenberg-Roberg, Michael, Die apokryphe Schrift als konserviertes Potential für zukünftige Paradigmenwechsel. Dieter Suhrs Ringen um die „Bewusstseinsverfassung“ seiner Zunft, in: Nikolaus Marsch/Laura Münkler/Thomas Wischmeyer (Hg.), Apokryphe Schriften, 2018, S. 151–170.
Lembcke, Oliver W., Hüter der Verfassung. Eine institutionentheoretische Studie zur Autorität des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 2007.
Lennartz, Jannis, Eine Grammatik der Freiheit? Zur gesellschaftspolitischen Dimension der Grundrechtsdogmatik, in: Hans-Michael Heinig/Frank Schorkopf (Hg.), 70 Jahre Grundgesetz. In welcher Verfassung ist die Bundesrepublik?, Götttingen 2019, S. 67–81.
Lepsius, Oliver, Wiedergelesen: Dietrich Jesch, Gesetz und Verwaltung, 1961, JZ 2004, S. 350–351.
Lepsius, Oliver, Sozialwissenschaften im Verfassungsrecht — Amerika als Vorbild?, JZ 2005, S. 1–13.
Lepsius, Oliver, Die maßstabsetzende Gewalt, in: Matthias Jestaedt u. a., Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin 2011, S. 159–279.
Lepsius, Oliver, Versammlungsrecht und gesellschaftliche Integration, in: Anselm Doering Manteuffel/Bernd Greiner/Oliver Lepsius, Der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 1985. Eine Veröffentlichung aus dem Arbeitskreis für Rechtswissenschaft und Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Tübingen 2015, S. 113–165.
Lepsius, Oliver, Kontextualisierung als Aufgabe der Rechtswissenschaft, JZ 2019, S. 793–802.
Lepsius, Oliver, Über die Notwendigkeit der Historisierung und Kontextualisierung für die Verfassungsdogmatik, in: Florian Meinel (Hg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bonner Republik, Tübingen 2019, S. 119–154.
Lepsius, Oliver, Problemzugänge und Denktraditionen im öffentlichen Recht, in: Eric Hilgendorf/Helmuth Schulze-Fielitz (Hg.), Selbstreflexion der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Tübingen 2021, S. 53–92.
Lepsius, Oliver, Die politische Funktion des Bundesverfassungsgerichts, APuZ 37/2021, S. 13–18.
Lepsius, Oliver, Nachweltschutz und Langzeitverantwortung im Verfassungsrecht, in: Horst Dreier (Hg.), Repräsentation und Legitimität im Verfassungs- und Umweltstaat. Gedächtnissymposion für Hasso Hofmann, Berlin 2022, S. 37–75.
Ley, Isabelle, Zwischen parlamentarischer Routine und exekutiven Kernbereichen. Die Kompetenzverteilung der auswärtigen Gewalt von Parlament und Regierung unter dem Grundgesetz, AöR 146 (2021), S. 299–352.
Lindner, Josef Franz, Theorie der Grundrechtsdogmatik, Tübingen 2005.
Lindner, Josef Franz/Unterreitmeier, Johannes, „Die Karlsruher Republik“ – wehrlos in Zeiten des Terrors, DÖV 2017, S. 90–98.
Loick, Daniel, Juridismus. Konturen einer kritischen Theorie des Rechts, Berlin 2017.
Luhmann, Niklas, Kontingenz als Eigenwert der modernen Gesellschaft (1992), in: ders., Beobachtungen der Moderne, 2. Aufl., Wiesbaden 2006, S. 93–128.
Magen, Stefan, Konjunkturen der Rechtsökonomik als öffentlich-rechtliche Grundlagenforschung, in: Andreas Funke/Julian Krüper/Jörn Lüdemann (Hg.), Konjunkturen in der öffentlich-rechtlichen Grundlagenforschung, Tübingen 2015, S. 103–123.
Mangold, Anna Katharina, Repräsentation von Frauen und gesellschaftlich marginalisierten Personengruppen als demokratietheoretisches Problem, in: Marion Eckertz-Höfer/Margarete Schuler-Harms (Hg.), Gleichberechtigung und Demokratie – Gleichberechtigung in der Demokratie: (Rechts-)Wissenschaftliche Annäherungen, Baden-Baden 2019, S. 109–124.
Mangold, Anna Katharina, Demokratische Inklusion durch Recht. Antidiskriminierungsrecht als Ermöglichungsbedingung der demokratischen Begegnung von Freien und Gleichen, Tübingen 2021.
Mangold, Anna Katharina, Relationale Freiheit. Grundrechte in der Pandemie, VVDStRL 80 (2021), S. 7–35.
Mangold, Anna Katharina, Soziale (Un)Gleichheit als Thema der Grundrechte, in: Jens Kersten/Stephan Rixen/Berthold Vogel (Hg.), Ambivalenzen der Gleichheit. Zwischen Diversität, sozialer Ungleichheit und Repräsentation, Bielefeld 2021, S. 73–93.
Mangold, Katharina/Payandeh, Mehrdad (Hg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, Tübingen 2022.
Manssen, Gerrit, Staatsrecht II. Grundrechte, München 2000.
Marquard, Odo, Apologie der Bürgerlichkeit (1994), in: ders., Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays, 2. Aufl., Stuttgart 2015, S. 247–260.
Masing, Johannes, Das Bundesverfassungsgericht, in: Matthias Herdegen u. a. (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts. Darstellung in transnationaler Perspektive, München 2021, § 15.
Mast, Tobias, Der Schutz geschlechtlicher Identität, in: Daniel Bernhard Müller/Lars Dittrich (Hg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 6, Berlin/Boston 2022, S. 329–358.
Maunz, Theodor, Deutsches Staatsrecht – Ein Studienbuch, München 1951.
Maurer, Hartmut, Staatsrecht I. Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, München 1999.
Meinel, Florian, Gleichheitsschutz für die Mehrheit. Das Verfassungsrecht und die Rückkehr der sozialen Frage, Merkur 2017, Heft 817, S. 35–46.
Meinel, Florian, Artikel „Etatismus“, in: Görres-Gesellschaft (Hg.), Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2, 8. Aufl. 2018, Sp. 251–254.
Meinel, Florian, Das Bundesverfassungsgericht in der Ära der Grossen Koalition: Zur Rechtsprechung seit dem Lissabon-Urteil, Der Staat 60 (2021), S. 43–98.
Meinel, Florian, Zur Zukunft der parlamentarischen Minderheitenrechte, Merkur 2021, Heft 869, S. 53–59.
Meinel, Florian, Die Staatsrechtslehrervereinigung und die Studentenbewegung, in: Pascale Cancik u. a. (Hg.), Streitsache Staat. Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 1922–2022, Tübingen 2022, S. 733–751.
Menke, Christoph, Kritik der Rechte, Berlin 2015.
Michl, Fabian, Situativ staatsgleiche Grundrechtsbindung privater Akteure. Zugleich Besprechung von BVerfG, Beschluss vom 11. 4. 2018 – 1 BvR 3080/09, JZ 2018, S. 910–918.
Michl, Fabian, Wiltraut Rupp-von Brünneck. Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin, Frankfurt/New York 2022.
Möllers, Christoph, Gewaltengliederung. Legitimation und Dogmatik im nationalen und internationalen Rechtsvergleich, Tübingen 2005.
Möllers, Christoph, Der vermisste Leviathan. Staatstheorie in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 2008.
Möllers, Christoph, Legalität, Legitimität und Legitimation des Bundesverfassungsgerichts, in: Matthias Jestaedt u. a., Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin 2011, S. 281–422.
Möllers, Christoph, Wir, die Bürger(lichen), Merkur 2017, Heft 818, S. 5–16.
Möllers, Christoph, Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik, Berlin 2020.
Möllers, Christoph, Demokratie, in: Matthias Herdegen u. a. (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts. Darstellung in transnationaler Perspektive, München 2021, § 5.
Möllers, Christoph, Struktur und Gegenstand des Curriculums im Verfassungsrecht – jenseits von Staatsbürgerkunde und Verrechtlichung, in: Julian Krüper (Hg.), Rechtswissenschaft lehren. Handbuch der juristischen Fachdidaktik, Tübingen 2022, § 17.
Möllers, Christoph/Weinberg, Nils, Die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Zum Beschluss des BVerfG v. 24. 3. 2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20, JZ 2021, S. 1069–1078.
Muckel, Stefan, Wandel des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft – Folgen für Grundrechtstheorie und Grundrechtsdogmatik, VVDStRL 79 (2020), S. 245–289.
Münkler, Herfried, Die Entstehung der Mitte. Ein Paradigma in Politik und Gesellschaft, in: Nadine M. Schöneck/Sabine Ritter (Hg.), Die Mitte als Kampfzone. Wertorientierungen und Abgrenzungspraktiken der Mittelschichten, Bielefeld 2018, S. 29–38.
Münkler, Laura, Expertokratie. Zwischen Herrschaft kraft Wissens und politischem Dezisionismus, Tübingen 2020.
Murswiek, Dietrich, Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 5, 1992, § 112.
Murswiek, Dietrich, Nationalstaatlichkeit, Staatsvolk und Einwanderung, in: Otto Depenheuer/Christoph Grabenwarter (Hg.), Der Staat in der Flüchtlingskrise. Zwischen gutem Willen und geltendem Recht, Paderborn 2016, S. 123–139.
Nettesheim, Martin, Liberaler Verfassungsstaat und gutes Leben. Über verfassungsrechtliche Grenzen ethisch imprägnierter Gesetzgebung, Paderborn 2017.
Neumann, Franz L./Nipperdey, Hans Carl/Scheuner, Ulrich (Hg.), Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, 7 Teilbände, ab 1954.
Neumann, Volker, Volkswille. Das demokratische Prinzip in der Staatsrechtslehre vom Vormärz bis heute, Tübingen 2020.
Neumeier, Christian, Kompetenzen. Zur Entstehung des deutschen öffentlichen Rechts, Tübingen 2022.
Nußberger, Angelika, Regieren: Staatliche Systeme im Umbruch, VVDStRL 81 (2022), S. 7–61.
Özmen, Elif, Was ist Liberalismus?, Berlin 2023.
van Ooyen, Robert Chr., Der Begriff des Politischen des Bundesverfassungsgerichts, Berlin 2005.
van Ooyen, Robert Chr., Bundesverfassungsgericht und politische Theorie. Ein Forschungsansatz zur Politologie der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden 2015.
van Ooyen, Robert Chr./Möllers, Martin H. W., „Der Staat ist von Verfassungs wegen nicht gehindert …“ National-liberaler Etatismus im Staatsverständnis des Bundesverfassungsgerichts, Baden-Baden 2021.
van Ooyen, Robert Chr., Parteipolitische Neutralität des Bundeskanzlers? Ein vordemokratisches Politikverständnis prägt die AfD-Entscheidung, RuP 58 (2022), S. 377–383.
Osterloh, Lerke, Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz – Entwicklungslinien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, EuGRZ 2002, S. 309–313.
Ottmann, Henning, „Antike ohne Ende“, Akademie Aktuell (Zeitschrift der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) 02/2015, S. 42–44.
Payandeh, Mehrdad, Das Gebot der Folgerichtigkeit: Rationalitätsgewinn oder Irrweg der Grundrechtsdogmatik?, AöR 136 (2011), S. 578–615.
Payandeh, Mehrdad, Die Neutralitätspflicht staatlicher Amtsträger im öffentlichen Meinungskampf. Dogmatische Systembildung auf verfassungsrechtlich zweifelhafter Grundlage, Der Staat 55 (2016), S. 519–550.
Pauly, Walter, Verfassungs- und Verfassungsprozeßrecht, in: Dietmar Willoweit (Hg.), Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur im 20. Jahrhundert, München 2007, S. 883–933.
Pernice, Ingolf, Carl Schmitt, Rudolf Smend und die europäische Integration, AöR 120 (1995), S. 100–120.
Petersen, Niels, Verhältnismäßigkeit als Rationalitätskontrolle. Eine rechtsempirische Studie verfassungsrechtlicher Rechtsprechung zu den Freiheitsgrundrechten, Tübingen 2015.
Petersen, Niels/Chatziathanasiou, Konstantin, Empirische Verfassungsrechtswissenschaft. Zu Möglichkeiten und Grenzen quantitativer Verfassungsvergleichung und Richterforschung, AöR 144 (2019), S. 501–535.
Piazolo, Michael (Hg.), Das Bundesverfassungsgericht. Ein Gericht im Schnittpunkt von Recht und Politik, Mainz 1995.
Pielhoff, Simon, Denken mit Geländer. Scott Shapiros Planning Theory of Law als Beitrag zur Kontextualisierung verfassungsgerichtlicher Maßstäbe, JöR 68 (2020), S. 241–270
Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard, Grundrechte – Staatsrecht II, Heidelberg 1985.
Plebuch, Jonas, Das dogmatisierende Jahrzehnt. Verfassungsrechtswissenschaft und Verfassungsgerichtsbarkeit in den 1980er Jahren, in: Martin Löhnig (Hg.), Beginn der Gegenwart. Studien zur juristischen Zeitgeschichte der 1980er Jahre, Göttingen 2021, S. 283–333.
Plebuch, Jonas, Rechtsfiguren als politische Waffen. Der U.S. Supreme Court und die US-amerikanische Rechtswissenschaft zwischen Recht und Politik, Verfassungsblog v. 17.10.2022, https://verfassungsblog.de/rechtsfiguren-als-politische-waffen/ (letzter Abruf 27.06.2023).
Plebuch, Jonas/Pielhoff, Simon, Verwaltungsstaat als Demokratieideal – Administrative State als Demokratiegefahr? Deutsches und US-amerikanisches Verwaltungsrecht zwischen Konvergenz und Divergenz, Der Staat 61 (2022), S. 167–203.
Poscher, Ralf, Grundrechte als Abwehrrechte. Reflexive Regelung rechtlich geordneter Freiheit, Tübingen 2003.
Poscher, Ralf, The Hand of Midas: When Concepts Turn Legal, or Deflating the Hart-Dworkin Debate, in: Jaap C. Hage/Dietmar von der Pfordten (Hg.), Concepts in Law, Dordrecht u. a., 2009, S. 99–115.
Preuß, Ulrich K., Ridders Konzept des grundgesetzlichen Demokratieprinzips, in: Isabel Feichtner/Tim Wihl (Hg.), Gesamtverfassung. Das Verfassungsdenken Helmut Ridders, Baden-Baden 2022, S. 65–85.
Rawls, John, Political Liberalism. Expanded Edition, New York 2005.
Redaktion Kritische Justiz (Hg.), Demokratie und Grundgesetz. Eine Auseinandersetzung mit der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, Baden-Baden 2000.
von Redecker, Eva, Bleibefreiheit, Frankfurt am Main 2023.
Rennert, Dominik, Die verdrängte Werttheorie und ihre Historisierung. Zu „Lüth“ und den Eigenheiten bundesrepublikanischer Grundrechtstheorie, Der Staat 53 (2014), S. 31–59.
Ridder, Helmut, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes. Leitfaden zu den Grundrechten einer demokratischen Verfassung, Opladen 1975.
Ridder, Helmut, Das Bundesverfassungsgericht. Bemerkungen über Aufstieg und Verfall einer antirevolutionären Einrichtung, in: Peter Römer (Hg.), Der Kampf um das Grundgesetz. Über die politische Bedeutung der Verfassungsinterpretation, Frankfurt am Main 1977, S. 70–86.
Rixen, Stephan, Demokratieprinzip und Gleichberechtigungsgebot: Verfassungsrechtliche Relationen, in: Marion Eckertz-Höfer/Margarete Schuler-Harms (Hg.), Gleichberechtigung und Demokratie – Gleichberechtigung in der Demokratie: (Rechts-)Wissenschaftliche Annäherungen, Baden-Baden 2019, S. 59–84.
Röhner, Cara, Ungleichheit und Verfassung. Vorschlag für eine relationale Rechtsanalyse, Weilerwist 2019.
Rückert, Joachim, Das Grundgesetz, kommentiert mit Geschichte, ZRG GA 136 (2019), S. 387–395.
Ruffert, Matthias, Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts. Eine verfassungsrechtliche Untersuchung zur Privatrechtswirkung des Grundgesetzes, Tübingen 2001.
Sachs, Michael, Besondere Gleichheitsgarantien, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hg.). Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 5, Heidelberg 1992, § 126.
Sacksofsky, Ute, Das Grundrecht auf Gleichberechtigung. Eine rechtsdogmatische Untersuchung zu Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, Baden-Baden 1991.
Sacksofsky, Ute, Religiöse Freiheit als Gefahr?, VVDStRL Bd. 68 (2009), S. 7–46.
Sacksofsky, Ute, Was heißt Ungleichbehandlung „wegen“?, in: Simon Kempny/Philipp Reimer (Hg.), Gleichheitssatzdogmatik heute. Beiträge und Ergebnisse des Gleichheitsrechtlichen Arbeitsgesprächs vom 3. bis 5. April 2016 in der Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln, Tübingen 2017, S. 63–90.
Sacksofsky, Ute, Geschlechterforschung im Öffentlichen Recht, JöR 67 (2019), S. 377–402.
Schaal, Gary S., Integration durch Verfassung und Verfassungsrechtsprechung. Über den Zusammenhang von Demokratie, Verfassung und Integration, Berlin 2000.
Schachtschneider, Karl Albrecht, Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam, 2. Aufl., Berlin 2011.
Scheid, Christopher, Demokratieimmanente Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit. Eine funktionelle und institutionelle Betrachtung, Der Staat 59 (2020), S. 227–276.
Schlaich, Klaus, Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen, VVDStRL 39 (1981), S. 99–146.
Schlink, Bernhard, Freiheit durch Eingriffsabwehr – Rekonstruktion der klassischen Grundrechtsfunktion, EuGRZ 1984, S. 457–468.
Schlink, Bernhard, Die Entthronung der Staatsrechtswissenschaft durch die Verfassungsgerichtsbarkeit, Der Staat 28 (1989), S. 161–172.
Schönberger, Christoph, „Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht“. Die Entstehung eines grundgesetzabhängigen Verwaltungsrechts in der frühen Bundesrepublik, in: Michael Stolleis (Hg.), Das Bonner Grundgesetz – Altes Recht und neue Verfassung in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland (1949–1969), Berlin 2006, S. 53–84.
Schönberger, Christoph, Anmerkungen zu Karlsruhe, in: Matthias Jestaedt u. a., Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin 2011, S. 9–76.
Schönberger, Christoph, Der Aufstieg der Verfassung: Zweifel an einer geläufigen Triumphgeschichte, in: Thomas Vesting/Stefan Korioth (Hg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts, Was bleibt von der Verfassung nach der Globalisierung?, Tübingen 2011, S. 7–22.
Schönberger, Christoph, Der Indian Summer eines liberalen Etatismus. Ernst-Wolfgang Böckenförde als Verfassungsrichter, in: Hermann-Josef Große Kracht/Klaus Große Kracht (Hg.), Religion – Recht – Republik. Studien zu Ernst-Wolfgang Böckenförde, Paderborn 2014, S. 121–136.
Schönberger, Christoph, Der „German Approach“ – Die deutsche Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich, Tübingen 2015.
Schönberger, Christoph, Identitäterä. Verfassungsidentität zwischen Widerstandsformel und Musealisierung des Grundgesetzes, JöR 63 (2015), S. 41–62.
Schönberger, Sophie, Wandel des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft – Folgen für Grundrechtstheorie und Grundrechtsdogmatik, VVDStRL 79 (2020), S. 291–318.
Scholz, Rupert/Konrad, Karlheinz, Meinungsfreiheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht. Zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 123 (1998), S. 60–121.
Schorkopf, Frank, Staat und Diversität. Agonaler Pluralismus für die liberale Demokratie, Paderborn 2017.
Schulze-Fielitz, Helmuth, Das Bundesverfassungsgericht in der Krise des Zeitgeists. Zur Metadogmatik der Verfassungsinterpretation, AöR 122 (1997), S. 1–31.
Schulze-Fielitz, Helmuth, Staatsrechtslehre als Mikrokosmos (2013), in: ders., Staatsrechtslehre als Mikrokosmos. Bausteine zu einer Soziologie und Theorie der Wissenschaft des Öffentlichen Rechts, 2. Aufl., Tübingen 2022, S. 3–44.
Schulze-Fielitz, Helmuth, Die Wissenschaft des Öffentlichen Rechts im Prozess der Selbstreflexion – eine (Zwischen-)Bilanz, in: Eric Hilgendorf/Helmuth Schulze-Fielitz (Hg.), Selbstreflexion der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Tübingen 2021, S. 353–389.
Schweda, Mark, Joachim Ritter und die Ritter-Schule zur Einführung, Hamburg 2015.
Starck, Christian, Über Auslegung und Wirkungen der Grundrechte, in: Bundesminister der Justiz (Hg.), Vierzig Jahre Grundrechte in ihrer Verwirklichung durch die Gerichte. Göttinger Kolloquium, München 1990, S. 9–34.
Stern, Klaus, Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Recht und Politik, Opladen 1980.
Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/1, München 1988; Bd. III/2, München 1994.
Stolleis, Michael, Staatsbild und Staatswirklichkeit in Westdeutschland (1945–1960), ZRG GA 124 (2007), S. 223–245.
Stolleis, Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 4: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in West und Ost 1945–1990, 2012.
Suhr, Dieter, Entfaltung des Menschen durch die Menschen. Zur Grundrechtsdogmatik der Persönlichkeitsentfaltung, der Ausübungsgemeinschaften und des Eigentums, Berlin 1976.
Sunstein, Cass R., Incompletely Theorized Agreements, Harvard Law Review 108 (1995), S. 1733–1772.
Taylor, Charles, Der Irrtum der negativen Freiheit (1979), in: ders., Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, Frankfurt am Main 1992, S. 118–144.
Thym, Daniel, Freundliche Übernahme, oder: Die Macht des „ersten Wortes“ – Recht auf Vergessen als Paradigmenwechsel, JZ 2020, S. 1017–1027.
Towfigh, Emanuel V., Empirical arguments in public law doctrine: Should empirical legal studies make a “doctrinal turn”?, International Journal of Constitutional Law (I.CON), 12 (2014), S. 670–691.
Valentiner, Dana-Sophie, Paritätsgesetze. Gleichberechtigung in der repräsentativen Demokratie, JöR 71 (2023), S. 209–227.
Vermeule, Adrian, Common Good Constitutionalism. Recovering the Classical Legal Tradition, Cambridge/Medford 2022.
Vesting, Thomas, Von der liberalen Grundrechtstheorie zum Grundrechtspluralismus. Elemente und Perspektiven einer pluralen Theorie der Grundrechte, in: Christoph Grabenwarter u. a. (Hg.), Allgemeinheit der Grundrechte und Vielfalt der Gesellschaft. 34. Tagung der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches Recht“, Stuttgart u. a. 1994, S. 9–24.
Vorländer, Hans (Hg.), Integration durch Verfassung, Opladen 2002.
Vorländer, Hans (Hg.), Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden 2006.
Volkmann, Uwe, Leitbildorientierte Verfassungsanwendung, AöR 134 (2009), S. 157–196.
Volkmann, Uwe, Bausteine zu einer demokratischen Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Michael Bäuerle/Philipp Dann/Astrid Wallrabenstein (Hg.), Demokratie-Perspektiven. Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, Tübingen 2013, S. 119–138.
Volkmann, Uwe, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 2013.
Volkmann, Uwe, Krise der konstitutionellen Demokratie. Reflexionen anlässlich der Lektüre einschlägiger Literatur, Der Staat 58 (2019), S. 643–658.
Volkmann, Uwe, Die Dogmatisierung des Verfassungsrechts. Überlegungen zur veränderten Kultur juristischer Argumentation, JZ 2020, S. 965–975.
Vosgerau, Ulrich, Staatliche Gemeinschaft und Staatengemeinschaft. Grundgesetz und Europäische Union im internationalen öffentlichen Recht der Gegenwart, Tübingen 2016.
Voßkuhle, Andreas, Verfassungsrechtliche Traditionsrezeption in Zeiten des Wandels: Die institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 4, 5 GG) und die Reform des öffentlichen Dienstrechts, in: Rainer Wahl (Hg.), Verfassungsänderung, Verfassungswandel, Verfassungsinterpretation. Vorträge bei deutsch-japanischen Symposien in Tokyo 2004 und Freiburg 2005, Berlin 2010, S. 471–493.
Voßkuhle, Andreas, Die Staatstheorie des Bundesverfassungsgerichts, in: ders./Christian Bumke/Florian Meinel (Hg.), Verabschiedung und Wiederentdeckung des Staates im Spannungsfeld der Disziplinen, Berlin 2013, S. 371–383.
Voßkuhle, Andreas, Die Zukunft der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa (2020), in: ders., Europa, Demokratie, Verfassungsgerichte, Berlin 2021, S. 344–363.
Voßkuhle, Andreas/Wischmeyer, Thomas, Die Verfassung der Mitte, München 2016.
Waechter, Kay, Einrichtungsgarantien als dogmatische Fossilien, Die Verwaltung 29 (1996), S. 47–72.
Waldhoff, Christian, Kritik und Lob der Dogmatik, in: Gregor Kirchhof/Stefan Magen/Karsten Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik? – Was leistet und wie steuert die Dogmatik des öffentlichen Rechts?, Tübingen 2012, S. 17–37.
Wapler, Friederike, Politische Gleichheit: demokratietheoretische Überlegungen, JöR 67 (2019), S. 427–455.
Würtenberger, Thomas, Zur Legitimität des Verfassungsrichterrechts, in: Bernd Guggenberger/Thomas Würtenberger (Hg.), Hüter der Verfassung oder Lenker der Politik? Das Bundesverfassungsgericht im Widerstreit, Baden-Baden 1998, S. 57–80.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2024 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this entry
Cite this entry
Plebuch, J. (2024). Verfassungsdogmatik der Bürgerlichkeit: Zum Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Staatsrechtslehre seit den 1980er-Jahren. In: van Ooyen, R.C., Möllers, M.H. (eds) Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37532-4_20-1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-37532-4_20-1
Received:
Accepted:
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-37532-4
Online ISBN: 978-3-658-37532-4
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)