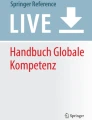Zusammenfassung
Einst als Gegenentwurf zur restaurativen Kulturpolitik der 1968er-Jahre entstanden, hat das „Prinzip Soziokultur“ (Knoblich 2001, S. 7) bis heute Bestand. Und vielmehr: Soziokulturelle Grundprinzipien der partizipativen Gestaltung des Miteinanders mit künstlerisch-kulturellen Mitteln haben inzwischen in zahlreichen Kulturfeldern Einzug gehalten. Soziokulturelle Akteurskonstellationen bringen Menschen in von Vielfalt geprägten Stadtzentren zusammen, erproben neue Konzepte der Landlebensgestaltung und stellen sich mit innovativen Ideen und großem Engagement mit ihren Projektaktivitäten dem, was die Menschen vor Ort bewegt. Trotz aller Erfolge und zukunftsweisenden Modelle ist die finanzielle Situation der meisten Akteur*innen der Soziokultur jedoch nach wie vor als prekär zu beschreiben. Ein Großteil der Einrichtungen und Initiativen finanziert seine gesellschaftsgestaltende Kulturarbeit nach wie vor mit einem mehr als abenteuerlichen Mix risikobehafteter Finanzierung. Nach wie vor fehlt es an kulturpolitischen Konzepten, dem Abbau bürokratischer Hürden und der Allianzen zur gemeinsamen Zielerreichung zwischen Kulturmacher*innen, Politik und Verwaltung.
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Der Bundesverband Soziokultur wurde 1979 unter dem Namen „Bundesvereinigung soziokultureller Zentren“ gegründet und vertritt seither die Interessen der soziokultureller Akteur*innen auf Bundesebene. Auf Länderebene existieren in den meisten Bundesländern entsprechende Landesverbände, die unter unterschiedlichen kulturpolitischen Förderstrukturen und Selbstverständnissen beratend, begleitend, fördernd, netzwerkend, Öffentlichkeitsarbeit und kulturpolitische Lobbyarbeit leistend für ihre Mitglieder aktiv sind. Zur Verbandsarbeit gehört auch die permanente Auseinandersetzung der Mitglieder, Vorstände und Vertreter*innen der Geschäftsstellen mit der eigenen Rolle und Positionierung, die sich in den letzten Jahren beispielsweise in der Umbenennung von Verbänden, aber auch in der Auseinandersetzung mit und Reaktion auf aktuelle Themen widerspiegelt. (Bundesverband Soziokultur 2022a, b, c; Sievers 2015, S. 13–18).
- 2.
Während unter dem Begriff der Einrichtungen die klassischen soziokulturellen Zentren zu verstehen sind, wird der Begriff der Initiative für Formate soziokultureller Arbeit verwendet, die über kein festes Haus als Veranstaltungszentrum verfügen, sondern dezentral, mobil oder in Netzwerkstrukturen arbeiten. (Bundesverband Soziokultur 2022a, b, c; Kegler 2020, S. 70–77).
- 3.
Im Gegensatz zum bis in die 1970er-Jahre vorherrschenden bürgerlich-affirmativen Kulturbegriff ist heute in der Regel von einem erweiterten Kulturverständnis auszugehen. Kultur wird im Gegensatz zur Natur gesehen, als Ausdruck aller menschengeprägten individuellen, gemeinschaftlichen, praktischen, theoretischen, mythischen und religiösen sowie ästhetischen Äußerungen (Schneider 2009, S. 1).
- 4.
Eine „Gesellschafts-Kultur“ im Gegenzug zur traditionellen bürgerlich-affirmativen Kunstpraxis zu fordern war damals durchaus folgerichtig. Wenn der Begriff „Soziokultur“ heute bereits als Pleonasmus verstanden werden kann, so zeigt dies umso deutlicher den Wandel des allgemeinen Kulturverständnisses. Zahlreiche Forderungen der damaligen soziokulturellen Bewegungen fanden inzwischen ihren Niederschlag in der Kulturpraxis und veränderten damit auch das Begriffsverständnis.
- 5.
Der Verein bietet unter allen Rechtsformen die größtmögliche Freiheit, das Miteinander bedarfsgerecht und für die jeweilige Gemeinschaft passend zu regeln, da die rechtlichen Auflagen zur Gründung und Führung von Vereinen minimal sind. Diese Freiheit erfordert wiederum die selbstorganisierte und eigenverantwortliche Aushandlung des „Wie-wollen-wir-miteinander-agieren“ unter den gleichberechtigten Mitgliedern mit ihren individuellen Interessen und ist damit per se ein Instrument der Einübung und Erprobung demokratischer Grundprinzipien (Deutscher Bundestag 2008, S. 9; Kegler 2020, S. 80–96). Die Forschung zum Demokratieförderung durch Vereine der Breitenkultur mag noch ausbaufähig sein, knüpft jedoch an Studien zum gesellschaftlichen Kapital ehrenamtlicher Interessengruppen an (Braun 2006, S. 4498–4508; Putnam 2000, S. 48–64).
- 6.
Die Jahresstatistik der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren verweist seit Jahren auf den hohen Anteil untertariflich Beschäftigter, der 2017 bei rund 80 % aller hauptberuflich in der Soziokultur Beschäftigten lag (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 2017).
- 7.
- 8.
Die Gesetzgebung in Deutschland, wie auch in anderen demokratischen Systemen, basiert auf dem durch das bereits in der Aufklärung entwickelte Selbstverständnis, dass es zur Freiheit des Menschen als vernunftbegabtem Wesen unabdingbar dazugehört, Entscheidungen über sein Leben eigenständig treffen zu können (Kant 1784, S. 481–494). Dazu gehört auch die politische Urteilsfähigkeit, die Fähigkeiten öffentliche Angelegenheiten (auch) kritische reflektieren zu können und sich „bestenfalls aktiv in Politik und Zivilgesellschaft“ einzubringen (Meyer-Heidemann 2020, S. 157). Dass es zur Einübung dieser Haltung und Übernahme der gesellschaftsgestaltenden Verantwortung auch einer Befähigung und geeigneter Rahmensetzungen bedarf, ist als einer der Kerngedanken der Frankfurter Schule bereits in den 1960er/1970er-Jahren in den politischen, Diskurs eingeflossen (Adorno 1979, S. 135–145).
Literatur
Aderhold, Jens, Carsten Mann, Jana Rückert-John, und Martina Schäfer. 2015. Experimentierraum Stadt: Good Governance für soziale Innovationen auf dem Weg zur Nachhaltigkeitstransformation. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_04_2015_experimentierraum_stadt_good_governance.pdf. Zugegriffen am 20.05.2022.
Adorno, Theodor W. 1979. Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959–1969. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Ahbe, Ellen. 2021. Soziokultur. https://www.soziokultur.de/soziokultur/. Zugegriffen am 06.03.2022.
Ahbe, Ellen, Georg Halupczok, Andreas Kämpf, Edda Rydzy, und Margret Staal. 2020. Dimensionen des Notwendigen. Ein Appell an uns selbst. SOZIOkultur 2:4–10.
Bauhaus, Peter. 2007. Grenzgebiet. Zero 10:7–9.
Bäumler, Verena. 2021. Kultur ja – aber Soziokultur? SOZIOkultur 1:25.
Bibliographisches Institut. 2013. Duden. http://www.duden.de/. Zugegriffen am 06.04.2022.
Braun, Sebastian. 2006. Soziale und politische Integration durch Vereine? Theoretische Ansätze und empirische Ergebnisse. In Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede: Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München, Teilband. 1 und 2, Hrsg. Karl-Siegbert Rehberg, 4498–4508. Frankfurt a. M.: Campus.
Bundesverband Soziokultur e.V. 2019. Was braucht’s? Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2019. Bundesverband Soziokultur. https://www.soziokultur.de/wp-content/uploads/2020/05/Statistik-2019.pdf. Zugegriffen am 23.03.2022.
———. 2021. 3, 2, 1… auf! Lage der soziokulturellen Zentren und Initiativen, Literatur- und Kulturzentren und kulturellen Initiativen 2021. Bundesverband Soziokultur. https://www.soziokultur.de/wp-content/uploads/2021/05/20210521_Ergebnisse_Blitzumfrage_1-2-3-...-auf-Lage-der-soziokulturellen-Zentren-2021.pdf. Zugegriffen am 23.03.2022.
———. 2022a. Bundesverband. https://www.soziokultur.de/bundesverband/. Zugegriffen am 01.09.2022.
———. 2022b. jetzt erst recht. https://www.soziokultur.de/seitensuche/?data=jetzt+erst+recht. Zugegriffen am 01.09.2022.
———. 2022c. Soziokultur. https://www.soziokultur.de/soziokultur/. Zugegriffen am 01.07.2022.
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 2009. Der Begriff Soziokultur. http://www.soziokultur.de/bsz/node/17. Zugegriffen am 21.01.2018, online nicht mehr abrufbar, zitiert in: Kegler, Beate. 2020. Soziokultur in ländlichen Räumen. Die kulturpolitische Gestaltung gesellschaftsgestaltender Kulturarbeit. München: Kopaed.
———. 2010. Soziokultur in Zahlen. Statistischer Bericht 2011. Berlin: Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
———. 2017. Ganz genau! Soziokulturelle Zentren in Zahlen. Statistischer Bericht der Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren e.V. https://soziokultur.de/produkt/statistik-2017/. Zugegriffen am 07.11.2023.
Dallmann, Gerd. 2015. Selbstverständnis der Soziokultur: Grundprinzipien soziokultureller Arbeit. In Handbuch Soziokultur mit Projekten aus Niedersachsen Heft 1, Hrsg. Stiftung Niedersachsen, 9–12. Hannover: Stiftung Niedersachsen.
Darian, Samo, Harriet Völker, Julia Diringer, und Gudrun Kirchhoff. 2022. Neue Ideen und Ansätze für die Regionale Kulturarbeit. Teil 1: Loslegen. Berlin: TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel und Deutsches Institut für Urbanistik.
Deutscher Bundestag. 2007. Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“. https://dserver.bundestag.de/btd/16/070/1607000.pdf. Zugegriffen am 06.03.2022.
———. 2008. Bedeutung der Vereine, Vereinskooperation (Netzwerke) für die demokratische Grundordnung. WD 1 – 052/0. https://www.bundestag.de/resource/blob/411746/6a24f717e2bad584bc800d28f638a002/WD-1-052-08-pdf-data.pdf. Zugegriffen am 30.08.2022.
Glaser, Hermann, und Karl-Heinz Stahl. 1974. Die Wiedergewinnung des Ästhetischen. Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur. München: De Gruyter.
Götzky, Doreen. 2013. Kulturpolitik in ländlichen Räumen. Eine Untersuchung von Akteuren, Strategien und Diskursen am Beispiel des Landes Niedersachsen. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:hil2-opus-1859. Zugegriffen am 31.08.2022.
Hauser, Nikolaus. 2020. Umbenennung in Bundesverband Soziokultur e.V. Pressemitteilung vom 29. April 2020. https://www.soziokultur.de/umbenennung-in-bundesverband-soziokultur-e-v/. Zugegriffen am 30.08.2022.
Hesse, Bernd. o.J. Soziokultur in Hessen. http://www.kulturportal-hessen.de/de/Themen/Soziokultur_in_Hessen/index.phtml. Zugegriffen am 19.01.2011, online nicht mehr abrufbar, zitiert in: Kegler, Beate. 2020. Soziokultur in ländlichen Räumen. Die kulturpolitische Gestaltung gesellschaftsgestaltender Kulturarbeit. München: Kopaed.
Hoffmann, Hilmar. 1979. Kultur für alle. Perspektiven und Modelle. Frankfurt a. M.: Fischer.
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft. 2010. Ist Soziokultur lehrbar? Materialien des Instituts für Kulturpolitik 12.
Jacomet, Cornelia, Markus Kissling, Ursula Knecht-Kaiser, und Fredi Murbach. 2007. Zukunftsfähige Soziokultur. Initiative ergreifen, Gesellschaft gestalten, Kulturschaffen, Kooperationen eingehen. Zürich: Zentrum Karl der Große.
Kant, Immanuel. 1784. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift 2:481–494.
Kegler, Beate. 2020. Soziokultur in ländlichen Räumen. Die kulturpolitische Herausforderung gesellschaftsgestaltender Kulturarbeit. München: Kopaed.
Klüver, Dorit. 2015. Soziokultur auf dem Land. Abenteuer Alltag. In Handbuch Soziokultur mit Projekten aus Niedersachsen Heft 1, Hrsg. Stiftung Niedersachsen, 37–38. Hannover: Stiftung Niedersachsen.
Knoblich, Tobias J. 2001. Das Prinzip Soziokultur – Geschichte und Perspektiven. Aus Politik und Zeitgeschichte 11:7–14.
———. 2003. Soziokultur in Ostdeutschland. Aus Politik und Zeitgeschichte 12:28–34.
LAKS Baden-Württemberg e.V. 2019. Kriterien für Kulturinitiativen und soziokulturelle Zentren zur Aufnahme in die LAKS Baden-Württemberg e.V. Stand 26. Juni 2019. https://www.laks-bw.de/fileadmin/default/Download/Mitgliedsantrag/Aufnahmekriterien%20fuer%20Soziokulturelle%20Zentren_%20Stand_26.06.19%20Broschuere.pdf. Zugegriffen am 01.09.2022.
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Bayern e.V. o.J. Was wir wollen. https://www.soziokultur-bayern.de/ueber-uns/. Zugegriffen am 06.03.2022.
LandKulturPerlen. 2023. Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. https://landkulturperlen.de. Zugegriffen am 01.05.2023.
Lauer, Thomas. 2019. Change Management: Grundlagen und Erfolgsfaktoren. Berlin: Springer.
Meyer-Heidemann, Christian. 2020. Mündigkeit. In Wörterbuch Politikunterricht, Hrsg. Sabine Achour, Matthias Busch, Peter Massing, und Christian Meyer-Heidemann. 156–158. Frankfurt a. M.: Wochenschau.
Oswald, Philipp, und Kerstin Faber. 2013. Raumpioniere in ländlichen Regionen. Neue Wege der Daseinsvorsorge. Dessau: Spector Books.
Pallas, Anne. 2016. Kulturarbeit in Sachsen. Vom Kulturhaus zur Soziokultur. In Jahrbuch für Kulturpolitik 2015/2016, Hrsg. Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, 227–237. Bielefeld: transcript.
Projektbüro Neulandgewinner. 2021. Subkultur im Industriebunker. https://neulandgewinner.de/projekte/hausdermoeglichkeiten/782-hausdermoeglichkeiten.html. Zugegriffen am 06.03.2022.
Putnam, Robert D. 2000. Bowling alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
Rehberg, Antonia. 2021. Evaluation des Förderprogramms sozioK_change der Stiftung Niedersachsen. https://www.soziokultur-change.de/programm/evaluation. Zugegriffen am 06.03.2022.
Röpke, Thomas. 2018. Bürgerschaftliches Engagement und Soziokultur. Viele Gemeinsamkeiten, wenig Gemeinsames? In Kulturelle Bildung online. https://www.kubi-online.de/artikel/buergerschaftliches-engagement-soziokultur-viele-gemeinsamkeiten-wenig-gemeinsames. Zugegriffen am 06.03.2022.
Schneider, Wolfgang. 2009. Think Global – Act Local, Kulturelle Identität als kommunalpolitischer Auftrag. Festrede zum 700-jährigen Jubiläum des Ortes Langenhain. 2. März 2009. Langenhain.
———. 2010. Soziokultur – eine Frage der Qualifikation? Kulturpolitische Anmerkungen zum Bedarf an kulturpädagogischen Nachwuchs. Materialien des Instituts für Kulturpolitik 12:73–76.
Sievers, Norbert. 2015. Soziokultur: Standortbestimmung und Perspektiven. In Handbuch Soziokultur mit Projekten aus Niedersachsen Heft 1, Hrsg. Stiftung Niedersachsen, 13–18. Hannover: Stiftung Niedersachsen.
Sievers, Norbert, und Bernd Wagner. 1994. Blick zurück nach vorn: Zwanzig Jahre Neue Kulturpolitik. Essen: Klartext.
Siewert, H.-Jörg. 2015. Wirkungsweisen der Soziokultur für Stadtteile, Regionen und ländliche Räume. Zukunftskongress Soziokultur. http://www.zukunftskongresssoziokultur.de/Material-und-Texte/H-Joerg-Siewert-Wirkungsweisen/. Zugegriffen am 04.06.2022.
Soziokultur Niedersachsen. 2023. Beratung und Fortbildung. Landesverband Soziokultur Niedersachsen e.V. https://soziokultur-niedersachsen.de/beratung.html. Zugegriffen am 01.05.2023.
———. o.J. Soziokultur. https://www.soziokultur-niedersachsen.de/files/pages/ueber-uns/verband/Das%20ist%20Soziokultur.pdf. Zugegriffen am 01.09.2022.
Staal, Margret. 2021. Selbstermächtigung in der Soziokultur. Zur Qualifizierung von Nachhaltigkeit. In Jetzt in Zukunft. Zur Nachhaltigkeit von Soziokultur, Hrsg. Wolfgang Schneider, Kristina Gruber, und Davide Brocchi, 191–193. München: oekom.
Steiner, Christine, und Thomas Putz. 2020. Über Häuser und Wurzeln. Soziokultur im Ländle und im Freistaat. Ein Gespräch. SOZIOkultur 4:8–10.
Trafo – Modelle für Kultur im Wandel. 2023. Regionalmanager*in Kultur. Kulturstiftung des Bundes. https://www.trafo-programm.de/1921_veranstaltungen/2634_kooperationen/3147_regionalmanager-in-kultur. Zugegriffen am 01.05.2023.
Wagner, Bernd. 2001. Soziokultur West – Soziokultur Ost. Aus Politik und Zeitgeschichte 11:3–6.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2024 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this entry
Cite this entry
Kegler, B. (2024). Soziokultur und soziokulturelle Praxisformen. In: Crückeberg, J., Heinicke, J., Kalbhenn, J., Landau-Donnelly, F., Lohbeck, K., Mohr, H. (eds) Handbuch Kulturpolitik. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34381-1_40-1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-34381-1_40-1
Received:
Accepted:
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-34381-1
Online ISBN: 978-3-658-34381-1
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)