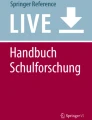Zusammenfassung
Das Konzept Intersektionalität dient dazu, das komplexe Zusammenspiel von Machtverhältnissen besser zu verstehen und gegen Diskriminierung vorzugehen. Gleichzeitig bleibt Intersektionalität auf dem Weg durch die Institution Universität nicht unberührt von den vorherrschenden Machtverhältnissen, und es besteht die Frage, wie Intersektionalität angesichts dieses Umstands weiterhin kritisch betrieben werden kann und an den Lebenserfahrungen von Personen mit intersektionalen Diskriminierungserfahrungen ausgerichtet bleibt. Anhand der Arbeiten von Patricia Hill Collins und Jennifer Nash argumentiere ich, dass es sowohl die Institutionalisierung von Intersektionalität als kritische Theorie sozialer Gerechtigkeit braucht (Institutionsarbeit) als auch die emotionale und politische Arbeit, die notwendig dafür ist, andere Lebenserfahrungen als die eigene so anzunehmen, dass die eigene Position dekomponiert bzw. durch das Gegenüber neu konfiguriert wird (Intimitätsarbeit).
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Siehe: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=de. Zugegriffen: 17.08.2020.
- 2.
Nash expliziert in diesem Zusammenhang, dass sie das Wort ‚Schwarz‘ vor ‚Feminismus‘ nicht als Identitätsmerkmal, sondern als politische Kategorie begreife und einen ‚Schwarzen feministischen Ansatz‘ als einen solchen verstehe, der die Analyse von rassialisierendem Heterosexismus in den Mittelpunkt stelle und Schwarze Frauen als intellektuelle Produzent*innen, kreative Akteur*innen, politische Subjekte und ‚Freiheitsträumer*innen‘ in den Vordergrund rücke, auch wenn Inhalt und Konturen dieser Träume divergierten (Nash 2019, S. 5).
- 3.
Die Großschreibung des Wortes Schwarz auch in adjektivischer Verwendung und die Kursiv- und Kleinschreibung des Wortes weiß geht auf den Vorschlag von Maisha Auma, Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susan Arndt zurück (Auma et al. 2005). Sie markieren mit dieser Schreibweise von ‚Schwarz‘ das Widerstandspotenzial von Schwarzen Menschen und People of Colour und mit der Schreibweise von ‚weiß‘ den rassialisierenden Konstruktcharakter dieser Kategorie. Im Anschluss an die Autor*innen wird der Begriff ‚Rasse‘ in Anführungszeichen geschrieben, wenn die biologistische Konstruktion gemeint ist, und kursiv, wann immer auf die Wissens- und kritische Analysekategorie rekurriert wird (S. 12).
- 4.
An dieser Stelle soll auf die Schwierigkeit der Kategorie „Frau“ hingewiesen werden. Die Kategorie „Frau“ ist weniger geschlossen, als die Formulierung häufig suggeriert und umfasst nicht nur cis Frauen, sondern auch trans* Frauen. Personen, die sich als nicht-binär verstehen, werden fälschlicherweise häufig binären Geschlechterkategorien zugeordnet. Somit soll an dieser Stelle auf die Konstruiertheit und Komplexität der Kategorie „Frau“ verwiesen werden, ohne die Lebenserfahrungen von trans* und nicht-binären Personen einfach darunter zu subsumieren.
- 5.
Die Frage besteht, ob Truth, die im Norden der USA aufgewachsen war und damit keinen Südstaaten-Dialekt hatte, nicht „I am a woman’s rights“ sagte, wie es eine andere Quelle vermuten lässt (Siebler 2010, S. 514). Siehe zum Vergleich der unterschiedlichen Versionen der Rede das Sojourner Truth Project: https://www.thesojournertruthproject.com/compare-the-speeches/. Zugegriffen: 06.01.2022.
- 6.
Hierbei handelt es sich um eine begrenzte Auswahl an Personen. Harriet Tubman befreite von etwa 1849 bis 1860 eine Vielzahl von versklavten Personen und setzte sich für Frauenrechte ein (Taylor 2017), Anna J. Cooper wies als Soziologin 1892 daraufhin, dass afroamerikanische Frauen sowohl die Frauenfrage als auch die Rassefrage zu stellen hätten (May 2009) und Pauli Murray kämpfte als Schwarze queere Person sowohl als intellektuelle*r Aktivist*in wie auch als Anwält*in und später als Pfarrer*in für umfassende Anerkennung (Rosenberg 2017; Collins 2019).
- 7.
Als weitere einschlägige Publikationen sind das von Gloria Anzaldúa und Cherrie Moraga erstmalig 1981 herausgegebene „This Bridge Called my Back: Writings by Radical Women of Color“ (Moraga und Anzaldúa 1983) und das ebenfalls 1981 von bell hooks verfasste „Ain’t I a Woman“ zu nennen, dessen Titel an Truths Rede erinnert (hooks 1981). Außerdem sind das 1982 von Akasha Gloria Hull, Patricia Scott und Barbara Smith herausgegebene „All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave“ (Hull et al. 1982) ebenso zu nennen wie Audre Lordes „Sister Outsider“ (Lorde 1984).
- 8.
Critical Race Studies sind in den US-amerikanischen Rechtswissenschaften zu verorten und als eine Intervention innerhalb der Critical Legal Studies zu verstehen. Critical Race Studies machen auf Rasse als Analyse- und Rechtskategorie aufmerksam und beschäftigen sich zentral mit Antidiskriminierungsrecht und der Frage von „interest convergence“ (Crenshaw 1995).
- 9.
Mit Verweis auf Clare Hemmings (2005) soll hier nicht eine Geschichte von Intersektionalität erzählt werden, die den 70er-Jahren reinen Essenzialismus basierend auf einer vermeintlich homogenen Kategorie „Frau“ zuschreibt. Allerdings sind in den 80er-Jahren Stimmen von Personen, die sich zu intersektionaler Diskriminierung äußern, stärker wahrnehmbar bzw. schlagen sich diese in Publikationen nieder.
- 10.
- 11.
Siehe hier die Kritik und die Forderungen von u. a. Maisha Auma, ADEFRA, von Emilia Roig (2018) und dem Center for Intersectional Justice, von Cengiz Barskanmaz und Nahed Samour und dem Critical-Race-Theory-Netzwerk ‚CRT-EUROPE‘. Barskanmaz und Samour machten ihre Positionen unter anderem im Gespräch mit Maisha Auma zu „diversity.intersektional“ im Rahmen der Vorlesungsreihe „Yallah Diversity!“, die 2021 stattfand deutlich. Zum Programm siehe: https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/diversity/_media/program-yallah.pdf. Bzgl. der Problematiken, die sich aus der fehlenden Institutionalisierung ergeben, siehe auch das Statement von ADEFRA (2020): http://www.adefra.com/index.php/blog/87-statement-von-adefra-schwarze-frauen-in-deutschland-e-v-anlaesslich-der-aktuellen-foerderzusage-des-bundestages-an-das-deutsche-zentrum-fuer-integrations-und-migrationsforschung-dezim-mit-insgesamt-neun-millionen-euro-zur-staerkung-der-rassismus-forschung. Zugegriffen: 19.08.2020.
- 12.
- 13.
Berlant weist in diesem Zusammenhang auf die Verortung von Intimität im Privaten hin und problematisiert die Trennung von öffentlich und privat – die Sphärentrennung, die feministische Wissenschaftler*innen von Beginn an kritisch beleuchtet haben (Berlant 1998, S. 283).
- 14.
Literatur
Alexander-Floyd, Nikol G. 2012. Disappearing acts: Reclaiming intersectionality in the social sciences in a post-black feminist era. Feminist Formations 24:1–25.
Apostolidou, Natascha. 1980. Arbeitsmigrantinnen und deutsche Frauenbewegung. Für die Frauenbewegung auch wieder nur ein ‚Arbeitsobjekt‘. Informationsdienst Ausländerarbeit 2:143–146.
Auma, Maisha, Grada Kilomba, Peggy Piesche, und Susan Arndt, Hrsg. 2005. Mythen, Masken und Subjekte: Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, 1. Aufl. Münster: Unrast.
Ayim, May. 1995. Blues in Schwarz Weiß. Berlin: Orlanda.
Ayim, May. 1997a. Grenzenlos und unverschämt. Berlin: Orlanda.
Ayim, May. 1997b. Nachtgesang. Berlin: Orlanda.
Ayim, May, Dagmar Schultz, und Katharina Oguntoye, Hrsg. 1984. Farbe bekennen: Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Berlin: Orlanda.
Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, Hrsg. 1990. Geteilter Feminismus – Rassismus, Antisemitismus, Fremdenhaß. Köln: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis.
Berlant, Lauren. 1998. Intimacy: A special issue. Critical Inquiry 24:281–288.
Bilge, Sirma. 2013. Intersectionality undone: Saving intersectionality from feminist intersectionality studies. Du Bois Review: Social Science Research on Race 10:405–424.
Butler, Judith. 2004. Beside oneself: On the limits of sexual autonomy. In Undoing gender, 17–39. New York/London: Routledge.
Butler, Judith. 2009. Außer sich: Über die Grenzen sexueller Autonomie. In Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 35–69. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Camlikbeli, Deniz. 1984. Deutsche Frauen – Türkische Frauen. Informationsdienst zur Ausländerarbeit 1:19.
Campt, Tina M. 1993. Afro-German cultural identity and the politics of positionality: Contests and contexts in the formation of a German ethnic identity. New German Critique 58:109.
Carbado, Devon W. 2013. Colorblind intersectionality. Signs: Journal of Women in Culture and Society 38:811–845.
Chebout, Lucy. 2012. Back to the roots! Intersectionality und die Arbeiten von Kimberlé Crenshaw. Portal Intersektionalität.
Collins, Patricia Hill. 1990. Black feminist thought. Knowledge, consciousness and the politics of empowerment. London/New York: Routledge.
Collins, Patricia Hill. 2019. Intersectionality as critical social theory. Durham: Duke University Press.
Collins, Patricia Hill, und Sirma Bilge. 2016. Intersectionality. Cambridge: Polity Press.
Crenshaw, Kimberlé. 1989. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. The University of Chicago Legal Forum 140:139–167.
Crenshaw, Kimberlé, Hrsg. 1995. Critical race theory: The key writings that formed the movement. New York: New Press.
Crenshaw, Kimberlé. 2011. Postscript. In Framing intersectionality: Debates on a multi-faceted concept in gender studies, Hrsg. Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik, 221–233. Farnham/Burlington: Ashgate.
Crenshaw, Kimberlé. 2019. Warum Intersektionalität nicht warten kann. In „Reach Everyone on the Planet …“ – Kimberlé Crenshaw und die Intersektionalität, Hrsg. Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit dem Center for Intersectional Justice. https://doi.org/10.25530/03552.11. Zugegriffen am 27.01.2020.
Davis, Kathy. 2020. Who owns intersectionality? Some reflections on feminist debates on how theories travel. European Journal of Women’s Studies 27:113–127.
Erel, Umut, Jin Haritaworn, Encarnación Gutiérrez Rodríguez, und Christian Klesse. 2007. Intersektionalität oder Simultaneität?! – Zur Verschränkung und Gleichzeitigkeit mehrfacher Machtverhältnisse – Eine Einführung. In Heteronormativität, Hrsg. Jutta Hartmann, Christian Klesse, Peter Wagenknecht, Bettina Fritzsche und Kristina Hackmann, 239–250. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
FeMigra. 1994. Wir, die Seiltänzerinnen. Politische Strategien von Migrantinnen gegen Ethnisierung und Assimilation. In Gender Killer. Texte zu Feminismus und Politik, Hrsg. Cornelia Eichhorn und Sabine Grimm. Berlin: ID-Verlag.
Gültekin, Nevâl. 1984. Eine schweigende Mehrheit meldet sich zu Wort. In Sind wir uns denn so fremd? Dokumentation des 1. gemeinsamen Kongresses ausländischer und deutscher Frauen. 23.–25. März 1984 in Frankfurt a. M, Hrsg. Arbeitsgruppe Frauenkongress, 3–11. Frankfurt a. M.
Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. 2011. Intersektionalität oder: Wie nicht über Rassismus sprechen? In Intersektionalität revisited: Empirische, theoretische und methodische Erkundungen, Hrsg. Sabine Hess, 77–100. Bielefeld: transcript.
Haritaworn, Jin. 2005. Am Anfang war Audre Lorde. Weißsein und Machtvermeidung in der queeren Ursprungsgeschichte. Femina Politica – Zeitschrift für Feministische Politikwissenschaft 14:23–35.
Hemmings, Clare. 2005. Telling feminist stories. Feminist Theory 6:115–139.
hooks, bell. 1981. Ain’t I a woman: Black women and feminism. London: South End Press.
Hügel-Marshall, Ika. 1998. Daheim unterwegs: Ein deutsches Leben. Frankfurt a. M.: Fischer.
Hügel-Marshall, Ika, et al. 1993. Entfernte Verbindungen: Rassismus, Antisemitismus, Klassenunterdrückung. Berlin: Orlanda.
Hull, Gloria T., Patricia Bell-Scott, und Barbara Smith, Hrsg. 1982. All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave: Black women’s studies. New York: CUNY Feminist Press.
Kalpaka, Annita, und Nora Räthzel. 1985. Paternalismus in der Frauenbewegung?! Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen eingewanderten und eingeborenen Frauen. Informationsdienst zur Ausländerarbeit 3:21–27.
Kraft, Marion. 1990. Frauen afrikanischer Herkunft: Feministische Kultur und Ethnizität in Amerika und Europa. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 13:25–44.
Lewis, Gail. 2013. Unsafe travel: Experiencing intersectionality and feminist displacements. Signs: Journal of Women in Culture and Society 38:869–892.
Lorde, Audre. 1984. Sister outsider: Essays and speeches. Berkeley: Crossing Press.
May, Vivian M. 2009. Writing the self into being: Anna Julia Cooper’s textual politics. African American Review 34:17–34.
Moraga, Cherríe, und Gloria Anzaldúa, Hrsg. 1983. This bridge called my back: Writings by radical women of color, 2. Aufl., 7th printing. New York: Kitchen Table.
Möser, Cornelia. 2013. Was die Intersektionalitätsdiskussion aus den feministischen Gender-Debatten in Frankreich und Deutschland lernen kann. In Intersectionality und Kritik: Neue Perspektiven für alte Fragen, Hrsg. Vera Kallenberg, Jennifer Meyer und Johanna M. Müller, 39–58. Wiesbaden: Springer VS.
Nash, Jennifer C. 2016. Unwidowing: Rachel Jeantel, black death, and the „problem“ of black intimacy. Signs: Journal of Women in Culture and Society 41:751–774.
Nash, Jennifer C. 2019. Black feminism reimagined: After intersectionality. Durham/London: Duke University Press.
Piesche, Peggy. 2012. „Euer Schweigen schützt Euch nicht“: Audre Lorde und die Schwarze Frauenbewegung in Deutschland, 2. Aufl. Berlin: Orlanda.
Popoola, Olumide, und Beldan Sezen, Hrsg. 1999. Talking home: Heimat aus unserer eigenen Feder: Frauen of Color in Deutschland. Amsterdam: Blue Moon Press.
Purtschert, Patricia, und Katrin Meyer. 2010. Die Macht der Kategorien. Kritische Überlegungen zur Intersektionalität. Feministische Studien 28:130–142.
Roig, Emilia. 2018. Intersectionality in Europe: A depoliticized concept? Völkerrechtsblog. https://voelkerrechtsblog.org/intersectionality-in-europe-a-depoliticized-concept/. Zugegriffen am 27.01.2020.
Rosenberg, Rosalind. 2017. Jane Crow: The life of Pauli Murray. New York: Oxford University Press.
Siebler, Kay. 2010. Far from the truth: Teaching the politics of Sojourner Truth’s „Ain’t I a Woman?“. Pedagogy Critical Approaches to Teaching Literature Language Composition and Culture 10:511–533.
Stötzer, Bettina. 2004. Indifferenzen: Feministische Theorie in der antirassistischen Kritik. Hamburg: Argument.
Strongman, Sara Ellen. 2021. Feeling black feminism, otherwise: A review of Jennifer C. Nash’s black feminism reimagined: After intersectionality (Durham, NC: Duke University Press, 2019). International Journal of Politics, Culture, and Society. https://doi.org/10.1007/s10767-021-09400-z.
Taylor, Keeanga-Yamahtta, Hrsg. 2017. How we get free: Black feminism and the Combahee River Collective. Chicago: Haymarket Books.
The Combahee River Collective. 1977. Black Feminist Statement.
Walgenbach, Katharina. 2012. Intersektionalität – eine Einführung. http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/ueberblickstexte/walgenbach-einfuehrung/. Zugegriffen am 27.01.2020.
Literaturempfehlungen
Collins, Patricia Hill. 2019. Intersectionality as critical social theory. Durham: Duke University Press.
Erel, Umut, Jin Haritaworn, Encarnación Gutiérrez Rodríguez, und Christian Klesse. 2007. Intersektionalität oder Simultaneität?! – Zur Verschränkung und Gleichzeitigkeit mehrfacher Machtverhältnisse – Eine Einführung. In Heteronormativität, Hrsg. Jutta Hartmann, Christian Klesse, Peter Wagenknecht, Bettina Fritzsche, und Kristina Hackmann, 239–250. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Nash, Jennifer C. 2019. Black feminism reimagined: After intersectionality. Durham/London: Duke University Press.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2022 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Wagner, L. (2022). Intersektionalität – machtvolle Institutionen, komplexe Identitäten und das Vermögen von Intimität. In: Biele Mefebue, A., Bührmann, A.D., Grenz, S. (eds) Handbuch Intersektionalitätsforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26292-1_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-26292-1_7
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-26291-4
Online ISBN: 978-3-658-26292-1
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)