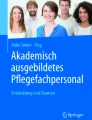Zusammenfassung
Ein Ziel der Bologna Reform war es, mit der Einführung von europaweit vergleichbaren Bachelor- und Masterstudiengängen einen einheitlichen europäischen Hochschulraum zu schaffen und die sozialen Ungleichheiten im Hochschulbereich abzubauen. Es zeigt sich jedoch, dass die weniger privilegierten Herkunftsgruppen durch die kürzeren Bachelorstudiengänge nicht häufiger ein Studium aufnehmen. Zudem zeichnen sich beim Übergang ins Masterstudium erhebliche herkunftsspezifische Unterschiede ab. Aufgrund der in Deutschland engen Kopplung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem und den unterschiedlichen Karriereaussichten von Bachelor- und Masterabsolventinnen und -absolventen stellt sich daher die Frage, ob die Studienstrukturreform neue herkunftsbedingte Ungleichheitsmuster auch beim Übergang in den Arbeitsmarkt hervorbringt. Diese Frage wird in dem vorliegenden Buchbeitrag mit Blick auf Einkommensunterschiede anhand verschiedener DZHW-Absolventenbefragungen aus den Jahren 2001, 2005 und 2009 (2. Welle) bearbeitet. Vor dem Hintergrund der Statusreproduktions- und Humankapitaltheorie wird argumentiert, dass sich die Bildungsinvestitionen im Hochschulbereich zunehmend zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen unterscheiden und daher die Einkommensungleichheiten zunehmen sollten. Aus den empirischen Ergebnissen geht zwar hervor, dass die Einkommensunterschiede zwischen 2001 und 2009 gewachsen sind und Hochschulabsolventinnen und -absolventen aus akademischem Elternhaus mittlerweile ein signifikant höheres Einkommen erzielen. Die Ursache dieser zunehmenden Einkommensungleichheiten ist allerdings – im Gegensatz zu den theoretischen Erwartungen – weniger auf die neue Studienstruktur zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine zunehmend unterschiedliche Investition in studienbegleitende Zusatzqualifikationen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
In der empirischen Bildungsforschung findet sich die Unterscheidung von quantitativen und qualitativen Bildungsinvestitionen oftmals auch unter der begrifflichen Unterscheidung von vertikalen und horizontalen Bildungsinvestitionen (vgl. Lörz 2017).
- 2.
Die Signaltheorie (Spence 1973) wird häufig ebenfalls zur Erklärung von Lohnunterschieden herangezogen. In Abgrenzung zur Humankapitaltheorie geht sie davon aus, dass Bildung nicht direkt die Produktivität von Erwerbstätigen erhöht, sondern eher als Signal für unterschiedliche Produktivitätspotenziale dient. Es steht demnach weniger die Investition in Bildung im Mittelpunkt, sondern vielmehr das Signal, welches von Bildung ausgeht. Der Lohn für eine bestimmte Stelle wird zudem allein von den Produktivitätserfordernissen der Stelle und nicht von der Bildung der Erwerbstätigen bestimmt. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nutzen höhere Bildung lediglich als Signal für eine geringe Einarbeitungszeit in den neuen Job. Ein nach Herkunftsgruppen unterschiedliches Investitionsverhalten und mögliche Veränderungen lassen sich aus dieser Perspektive jedoch nicht eindeutig begründen.
- 3.
Studierende in weiteren Qualifizierungsphasen wurden ausgeschlossen, da sie noch kein Markteinkommen gemäß ihrem Abschluss erzielen können. Selbständige Personen erhalten kein Einkommen aus abhängiger Beschäftigung, sondern erzielen Gewinne oder Verluste, was theoretisch anderen Mechanismen unterliegt als in der Humankapitaltheorie postuliert. Insgesamt werden 7388 Hochschulabsolventinnen und -absolventen aufgrund der oben genannten Merkmale von der Analyse ausgeschlossen (siehe Anhangstabelle Tab. 3).
- 4.
Auf Basis von neueren Daten ist es sicherlich möglich, das Herkunftskonzept differenzierter und die zugrund liegenden Mechanismen adäquater zu erfassen, allerdings ist dies in der vorliegenden Analyse nicht möglich, da die Veränderungen im Zeitverlauf im Mittelpunkt der Analyse stehen und hierfür vergleichbare Messinstrumente erforderlich sind.
- 5.
Weitere für das Einkommen relevante Kontrollvariablen, wie z. B. die Größe des Unternehmens, das Innehaben von Leitungspositionen oder die Studienabschlussnote konnten entweder aufgrund zu vieler fehlender Werte oder nicht vergleichbarer Operationalisierungen nicht berücksichtigt werden.
- 6.
In den Anhangstabellen finden sich in Modell 2 hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Studienabschluss und Brutto-Stundenlohn zunächst nur geringfügige Unterschiede. Wird jedoch für die Berufserfahrung kontrolliert, zeigen sich die erwarteten negativen Auswirkungen eines Bachelorabschlusses auf den Brutto-Stundenlohn.
Literatur
Alesi, B., Schomburg, H. & Teichler, U. (2010). Humankapitalpotenziale der gestuften Hochschulabschlüsse. In B. Alesi (Hrsg.) Aktuelle hochpolitische Trends im Spiegel von Expertisen. Internationalisierung, Strukturwandel, Berufseinstieg für Absolventen (S. 129–195). Kassel: Jenior.
Auspurg, K. & Hinz, T. (2011). Master für Alle? Der Einfluss sozialer Herkunft auf den Studienverlauf und das Übertrittsverhalten von Bachelorstudierenden. Soziale Welt 62: 75–99.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2014). Bildung in Deutschland 2014. Bielefeld: Bertelsmann.
Bastin, S., Dingeldey, I. & Fuchs, C. (2017). Motive studentischer Erwerbsarbeit: Zwischen Finanzierung und Qualifizierung. Reihe Arbeit und Wirtschaft in Bremen 17. Bremen: Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW).
Becker, G.S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy 70 (5, Part 2): 9–49.
Becker, G.S. (1964). Human Capital. New York: Columbia University Press.
Bourdieu, P. (1982). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Erdsiek, D. (2016). Overqualification of graduates: assessing the role of family background. Journal of Labour Market Research 49: 253–268.
Fabian, G., Rehn, T., Brandt, G. & Briedis, K. (2013). Karriere mit Hochschulabschluss? Hochschulabsolventinnen und -absolventen des Prüfungsjahrgangs 2001 zehn Jahre nach dem Studienabschluss. HIS Forum Hochschule 10/2013. Hannover: HIS.
Falkenhagen, T. (2013). Selektion oder Öffnung am Übergang vom Bachelor zum Masterstudium? In S. Siebholz, E. Schneider, A. Schippling, S. Busse & S. Sandring (Hrsg.) Prozesse sozialer Ungleichheit (S. 69–85). Wiesbaden: Springer VS.
Heine, C. (2012). Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium. Hannover: HIS.
Hochschulrektorenkonferenz (2016). Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland: Studiengänge, Studierende, Absolventinnen und Absolventen. Wintersemester 2015/2016. Statistiken zur Hochschulpolitik 1/2015. Bonn: HRK.
Jacob, M. & Klein, M. (2013). Der Einfluss der Bildungsherkunft auf den Berufseinstieg und die ersten Erwerbsjahre von Universitätsabsolventen. Beiträge zur Hochschulforschung 35 (1): 8–37.
Jacob, M., Klein, M. & Iannelli, C. (2015). The impact of social origin on graduates’ early occupational destinations: an Anglo-German comparison. European Sociological Review 31 (4): 460–476.
Jaksztat, S. (2014). Bildungsherkunft und Promotionen: Wie beeinflusst das elterliche Bildungsniveau den Übergang in die Promotionsphase? Zeitschrift für Soziologie 43 (4): 286–301.
Jaksztat, S. & Lörz, M. (2018). Ausmaß, Entwicklung und Ursachen sozialer Ungleichheit beim Zugang zur Promotion zwischen 1989–2009. Zeitschrift für Soziologie 47(1): 46–64.
Keller, S. & Zavalloni, M. (1962). Ambition and Social-Class. Public Opinion Quarterly 26 (3): 452–453.
Kretschmann, C. (2008). Studienstrukturreform an deutschen Hochschulen: Soziale Herkunft und Bildungsentscheidungen. Eine empirische Zwischenbilanz zum Bologna-Prozess. SOFI Working paper 3/2008. Göttingen: Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen e.V.
Leuze, K. (2011). Higher education and graduate employment: the importance of occupational specificity in Germany and Britain. In J. Clasen (Hrsg.) Converging worlds of welfare? British and German Social Policy in the 21st Century (S. 245–265). Oxford: Oxford University Press.
Leuze, K. & Allmendinger, J. (2008). Ungleiche Karrierepfade. Institutionelle Differenzierung und der Übergang von der Hochschule in den Arbeitsmarkt. In B.M. Kehm (Hrsg.) Hochschule im Wandel (S. 65–85). Frankfurt/Main: Campus.
Leuze, K. & Strauß, S. (2009). Lohnungleichheiten zwischen Akademikerinnen und Akademikern: Der Einfluss von fachlicher Spezialisierung, frauendominierten Fächern und beruflicher Segregation. Zeitschrift für Soziologie 38 (4): 262–281.
Kratz, F. & Netz, N. (2018). Which mechanisms explain monetary returns to international student mobility? Studies in Higher Education 43(2), 375–400.
Lörz, M. (2012). Mechanismen sozialer Ungleichheit beim Übergang ins Studium: Prozesse der Status- und Kulturreproduktion. In R. Becker & H. Solga (Hrsg.) Soziologische Bildungsforschung (S. 302–324). Wiesbaden: Springer VS.
Lörz, M. (2013). Differenzierung des Bildungssystems und soziale Ungleichheit: Haben sich mit dem Ausbau der beruflichen Bildungswege die Ungleichheitsmechanismen verändert? Zeitschrift für Soziologie 42 (2): 118–137.
Lörz, M. (2017). Soziale Ungleichheiten beim Übergang ins Studium und im Studienverlauf. In M. Baader & T. Freytag (Hrsg.) Bildung und Ungleichheit in Deutschland (S. 311–338). Wiesbaden: Springer VS.
Lörz, M., Netz, N. & Quast, H. (2016). Why do students from underprivileged families less often intend to study abroad? Higher Education 72 (2): 153–174.
Lörz, M., Quast, H. & Roloff, J. (2015). Konsequenzen der Bologna-Reform: Warum bestehen auch am Übergang vom Bachelor- ins Masterstudium soziale Ungleichheiten? Zeitschrift für Soziologie 44: 137–155.
Lörz, M. & Schindler, S. (2011). Bildungsexpansion und soziale Ungleichheit: Zunahme, Abnahme oder Persistenz ungleicher Chancenverhältnisse – eine Frage der Perspektive? Zeitschrift für Soziologie 40 (6): 458–477.
Lucas, S. (2001). Effectively maintained inequality: Education transitions, track mobility, and social background effects. American Journal of Sociology 106 (6): 1642–1690.
Mayer, K.U., Müller, W. & Pollak, R. (2007). Germany: Institutional Change and Inequalities of Access in Higher Education. In Y. Shavit, R. Arum & A. Gamoran (Hrsg.) Stratification in Higher Education. A Comparative Study (S. 240–265). Stanford: Stanford University Press.
Mullen, A.L., Goyette, K.A. & Soares, J.A. (2003). Who Goes to Graduate School? Social and Academic Correlates of Educational Continuation after College. Sociology of Education 76 (2): 143–169.
Müller, C. & Reimer, M. (2015). Einkommen von Bachelor und Diplomabsolventen: Die Rolle von Fach und Arbeitsmarkt. Beiträge zur Hochschulforschung 37 (2): 88–114.
Neugebauer, M. (2015). The Introduction of Bachelor Degrees and the Underrepresentation of Students from Low Social Origins in Higher Education in Germany: A Pseudo-Panel Approach. European Sociological Review 31 (5): 591–602.
Neugebauer, M., Neumeyer, S. & Alesi, B. (2016). More diversion than inclusion? Social stratification in the Bologna system. Research in Social Stratification and Mobility 45: 51–62.
Neugebauer, M. & Weiss, F. (2017). Does a bachelor’s degree pay off? Labor market outcomes of academic versus vocational education after Bologna. School of Business and Economics Discussion Papers. Berlin: School of Business and Economics.
Noelke, C., Gebel, M. & Kogan, I. (2012). Uniform Inequalities: Institutional Differentiation and the Transition from Higher Education to Work in Post-socialist Central and Eastern Europe. European Sociological Review 28 (6): 704–716.
Ortenburger, A. (2013). Beratung von Bachelorstudierenden in Studium und Alltag. Ergebnisse einer HISBUS-Befragung zu Schwierigkeiten und Problemlagen von Studierenden und zur Wahrnehmung, Nutzung und Bewertung von Beratungsangeboten. HIS Forum Hochschule 3/2013. Hannover: HIS.
Polachek, S.W. (1981). Occupational Self-Selection: A Human Capital Approach to Sex Differences in Occupational Structure. The Review of Economics and Statistics 63 (1): 60–69.
Purcell, K., Elias, P., Atfield, G., Behle, H., Ellison, R., Luchinskaya, D., Snape, J., Conaghan, L. & Tzanakou, C. (2012). Futuretrack Stage 4: Transitions into employment, further study and other outcomes. Warwick: Institute for Employment Research and HECSU.
Quast, H., Scheller, P. & Lörz, M. (2014). Bildungsentscheidungen im nachschulischen Verlauf. HIS Forum Hochschule 9/2014. Hannover: HIS.
Reimer, D. & Pollak, R. (2010). Educational Expansion and Its Consequences for Vertical and Horizontal Inequalities in Access to Higher Education in West Germany. European Sociological Review 26: 415–430.
Rehn, T., Brandt, G., Fabian, G. & Briedis, K. (2011). Hochschulabschlüsse im Umbruch. Studium und Übergang von Absolventinnen und Absolventen reformierter und traditioneller Studiengänge des Jahrgangs 2009. Hannover: HIS.
Sarcletti, A. (2007). Der Nutzen von Kontakten aus Praktika und studentischer Erwerbstätigkeit für den Berufseinstieg von Hochschulabsolventen. Beiträge zur Hochschulforschung 29(4), 52–80.
Schomburg, H. (2011). Bachelor Graduates in Germany: Internationally Mobile, Smooth Transition and Professional Success. In H. Schomburg und U. Teichler (Hrsg.) Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe – Key Results of the Bologna Process (S. 89–110). Rotterdam: Sense Publ.
Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics 87(3): 355–374.
Strauß, S. & Leuze, K. (2011). Einkommenseffekte der Weiterbildung von Hochschulabsolventen: Welchen Einfluss haben Weiterbildungsquantität und -qualität? Beiträge zur Hochschulforschung 4/2011: 36–57.
Teichler, U. (2005). Hochschulstrukturen im Umbruch. Eine Bilanz der Reformdynamik seit vier Jahrzehnten. Frankfurt/Main: Campus Verlag.
Wales, P. (2013). Access All Areas? The Impact of Fees and Background on Student Demand for Postgraduate Higher Education in the UK. SERC Discussion Paper 128. London: SERC.
Zhang, L. (2005). Advance to graduate education: The effect of college quality and undergraduate majors. Review of Higher Education 28 (3): 313–338.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Tabellenanhang
Tabellenanhang
Rights and permissions
Copyright information
© 2019 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Lörz, M., Leuze, K. (2019). Der Masterabschluss als neues Distinktionsmerkmal? Konsequenzen der Studienstrukturreform für herkunftsbedingte Einkommensungleichheiten. In: Lörz, M., Quast, H. (eds) Bildungs- und Berufsverläufe mit Bachelor und Master. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22394-6_11
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-22394-6_11
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-22393-9
Online ISBN: 978-3-658-22394-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)