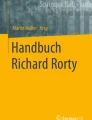Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird Richard Rortys „liberale Ironikerin“ mit der Ironie bei Sokrates und Søren Kierkegaard in Verbindung gebracht. Die drei Vergleichspunkte sind hierbei: erstens Ironie und Wahrheit, zweitens Ironie und Gespräch und drittens Ironie als Lebensform. Während bei Sokrates die Ironie noch zur universalen Wahrheit führen will, betont Kierkegaard mit seinem Ironiebegriff bereits die Bedeutung einer individuellen Wahrheit. Rortys „liberale Ironie“ wendet sich gegen jegliche ontologische Wahrheit. Bei allen drei Vertretern hat die Ironie einen dialogischen Charakter. Unter dem Punkt Ironie und Gespräch werden auch literarische und performative Aspekte der Ironie untersucht. Schließlich ist die Ironie für alle drei Autoren eine Haltung und Lebensform.
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
- 2.
Für eine allgemeine Diskussion der Ironie siehe Böhme 1988, S. 142–156.
- 3.
- 4.
Diese Zusammenfassung folgt in großen Zügen Richard Bernsteins Diskussion des Sokrates, siehe Bernstein 2016, S. 54–73.
- 5.
Ich danke Martin Müller für den Hinweis auf den Kriton-Dialog. Siehe auch Müller 2014, S. 213–214.
- 6.
- 7.
Kierkegaard drückt destruktiv und konstruktiv mit den Begriffen negativ und positiv aus.
- 8.
- 9.
Auch wenn dies wie Schaper zeigt die tragende Bedeutung des Absoluten und Religiösen verkürzt (Schaper 1994, S. 15–26).
- 10.
Diese Auslegung findet sich bei Bernstein 2016, S. 94–101.
- 11.
- 12.
Diese Pseudonyme enthalten selbst oft philosophische Aussagen und beziehen sich auf Konzepte, Begriffe und Traditionen, wie etwa Die Wiederholung von Constantin Constantius, die Krankheit zum Tode von Anti-Climacus oder Die Unwissenschaftliche Nachschrift von Johannes Climacus.
- 13.
Siehe auch Rorty 1986.
- 14.
Für einen ausführlichen Vergleich von Kierkegaards und Rortys Ironieverständnis siehe Frazier 2006.
- 15.
- 16.
Rorty identifiziert sich mit seiner Ironikerin (Rorty 1989a, S. 78–79).
- 17.
Müller spricht von einer „Radikalisierung der ontologisch orientierten sokratischen Ironie“ (Müller 2014, S. 96).
Literatur
Altrichter, Rudolf, und Elisabeth Ehrensperger. 2010. Sokrates. Bern: Haupt UTB.
Arendt, Hannah. 2016. Sokrates. Apologie der Pluralität. Berlin: Matthes & Seitz.
Bernstein, Richard J. 2016. Ironic life. Cambridge/Malden: Polity.
Böhme, Gernot. 1988. Der Typ Sokrates. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Curtis, William. 2015. Defending rorty. Pragmatism and liberal virtue. New York: Cambridge University Press.
Frazier, Brad. 2006. Rorty and Kierkegaard on irony and moral commitment. Philosophical and theological connections. New York: Palgrave Macmillan.
Frischmann, Bärbel. Hrsg. 2014. Ironie in der Philosophie und philosophischen Ironie. In Ironie in Philosophie, Literatur und Recht, Würzburg: Königshausen und Neumann.
Gascoigne, Neil. 2008. Richard Rorty. Liberalism, irony and the ends of philosophy. Cambridge: Polity.
Grøn, Arne. 2008. The concept of anxiety in Søren Kierkegaard. Macon: Mercer University Press.
Kahn, Charles H. 1998. Plato and the socratic dialogue. The philosophical use of a literary form. Cambridge: Cambridge University Press.
Kierkegaard, Sören. 1984. Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. In Søren Kierkegaard: Gesammelte Werke. 31, Hrsg. Emanuel Hirsch und Hayo Gerdes. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Kierkegaard, Søren. 1985. Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den philosophischen Brocken. Zweiter Teil. In Søren Kierkegaard: Gesammelte Werke. 16/2, Hrsg. Emanuel Hirsch und Hayo Gerdes. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Mackey, Louis. 1969. Philosophy and poetry in Kierkegaard. The Review of Metaphysics. 23(2): 316–332.
Mackey, Louis. 1971. Kierkegaard: A kind of poet. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Martens, Ekkehard. 2016. Sokrates. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam.
Müller, Martin. 2014. Private Romantik, öffentlicher Pragmatismus? : Richard Rortys transformative Neubeschreibung des Liberalismus. Bielefeld: transcript.
Nehamas, Alexander. 1998. The art of living. Socratic reflections from Plato to Foucault. Berkeley: University of California Press.
Pattison, George. 1997. If Kierkegaard is right about reading, why read Kierkegaard? In Kierkegaard revisited. Proceedings from the conference „Kierkegaard and the meaning of meaning it“, Hrsg. Niels Jørgen Cappelørn und Jon Stewart, 291–309. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Pattison, George. 1999. Kierkegaard. The aesthetic and the religious: From the magic theatre to the crucifixion of the image. London: SCM.
Platon. 1982. In Sämtliche Werke, Hrsg. Erich Loewenthal. Heidelberg: Lambert Schneider.
Possen, David D. 2010. Protagoras and republic: Kierkegaard on socratic irony. In Socrates and Plato, Hrsg. Jon Stewart und Katalin Nun, 87–104. Farnham: Ashgate.
Rorty, Richard. 1986. The contingency of selfhood. London Review of Books, May 8. 11–15.
Rorty, Richard. 1989a. Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.
Rorty, Richard. 1989b. Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Rorty, Richard, und Eduardo Mendieta. 2006. Take care of freedom and truth will take care of itself. Interviews with Richard Rorty. Standford: Stanford University Press.
Schaper, Susanne. 1994. Ironie und Absurdität als philosophische Standpunkte. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Schlegel, Friedrich von. 1962. Dichtungen. In Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Hrsg. Ernst Behler. Paderborn: Schöning.
Söderquist, K. Brian. 2002. The religious „suspension of the ethical“ and the ironic „suspension of the ethical“: The problem of actuality in fear and trembling. In Kierkegaard studies yearbook, Hrsg. Heiko Schulz und Jon Stewart, 259–276. Berlin: De Gruyter.
Söderquist, K. Brian. 2007. The isolated self. Irony as truth and untruth in Søren Kierkegaardʼs on the concept of irony. Copenhagen: Reitzel.
Söderquist, K. Brian. 2013. Irony. In The oxford handbook of Kierkegaard, Hrsg. John Lippitt und George Pattison, 344–362. Oxford: Oxford University Press.
Theunissem, Michael. 1958. Der Begriff Ernst bei Søren Kierkegaard. Freiburg: Alber.
Vlastos, gregory. 1987. Socratic irony. The Classical Quarterly 37(1): 79–96.
Vlastos, Gregory. 1991. Socrates. Ironist and moral philosopher. Cambridge: Cambridge University Press.
Voparil, Christopher. 2016. Rorty and James on irony, moral commitment, and the ethics of belief. William James Studies. 12(2): 1–27.
Kommentierte Literatur
Bernstein, Richard. 2016. Ironic life. Cambridge/Malden: Polity.
Bernstein umreißt in seinem Buch die aktuelle Diskussion um den Begriff der Ironie bei Nehamas, Lear und Rorty. Dabei präsentiert er auch seine eigene Interpretation von Sokrates, Ironie bei Kierkegaard und Rorty, um seine Idee von einem „ironischen Leben“ darzustellen
Söderquist, K. Brian. 2007. The isolated self. Kopenhagen: C.A. Reitzel.
Ausführliche Diskussion der philosophiegeschichtlichen Hintergründe zu Kierkegaards Ironiebegriffs. Söderquist geht beispielsweise auf Hegel, Schlegel und die Diskussion des Ironiebegriffs bei Zeitgenossen Kierkegaards in Kopenhagen ein
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Section Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 2019 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this entry
Cite this entry
Tautz, B. (2019). Richard Rorty und die Klassiker der Ironie als Lebensform (Sokrates, Kierkegaard). In: Müller, M. (eds) Handbuch Richard Rorty. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16260-3_68-1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-16260-3_68-1
Received:
Accepted:
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-16260-3
Online ISBN: 978-3-658-16260-3
eBook Packages: Springer Referenz Sozialwissenschaften und Recht