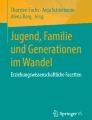Zusammenfassung
Kinder- und Familienarmut sind in Deutschland Realität. Jedes vierte Kind wächst unter Armutsbedingungen auf. Familien in prekären Lebenslagen haben dabei in ihrem Alltag eine Reihe von Herausforderungen, die mit der Armutslage verbunden sind, zu bewältigen. Gleichwohl sind Familien in prekären Lebenslagen keine homogene Gruppe; es zeigen sich Unterschiede unter anderem bei den Familienformen, der Anzahl der Kinder, den Herkunftskontexten oder der sozialen Einbindung. Nichtsdestotrotz gibt es vergleichbare strukturelle Probleme, häufig eine große Vielzahl von gleichzeitig auftretenden Belastungen in den Familien und damit einhergehende ähnliche Bedarfe. Der Beitrag fragt danach was Familienmitglieder als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenslagen als größte Belastung erleben und was sie für ein gutes Leben benötigen. Er basiert auf qualitativen Befragungen von Elternteilen und Familien in drei Regionen in Deutschland. Alle beteiligten Familien lebten zur Zeit der Befragung unter Armutsbedingungen. Im Fokus der Untersuchung standen die Sichtweisen der Familien auf ihren Alltag und das Unterstützungssystem, aber auch Fachkräfte in den Kommunen wurden befragt.
Dieser Artikel basiert auf der Studie Sabine Andresen und Danijela Galic (2015). Kinder – Armut – Familie. Alltagsbewältigung und Wege zu wirksamer Unterstützung. Gütersloh.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Nussbaum formuliert folgende „Befähigungen“ für ein erfülltes menschliches Leben: Die Befähigung, ein volles Menschenleben bis zum Ende zu führen; Gesundheit (insbesondere durch Ernährung), Wohnen, Sexualität und Mobilität; die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu haben; die Befähigung, fünf Sinne zu benutzen, sich etwas vorstellen und denken zu können; Bindungen zu Dingen und Personen einzugehen, zu lieben, zu trauern, Sehnsucht und Dankbarkeit zu empfinden; sich Vorstellungen vom Guten zu machen und kritisch über die eigene Lebensplanung nachzudenken; für andere und bezogen auf andere zu leben, verschiedene Formen familiärer und sozialer Beziehungen einzugehen; Verbundenheit mit Tieren und Pflanzen und der ganzen Natur zu (er-)leben; die Befähigung zu lachen, zu spielen und Freude an Erholung zu haben; das eigene Leben und nicht das eines anderen zu leben; die Befähigung, sein eigenes Leben in seiner eigenen Umgebung und seinem eigenen Kontext zu leben (Nussbaum 1999, 2000).
- 2.
In keinem der von uns verwendeten Memory-Sets gab es eine Karte mit Münzen oder Geldscheinen. Die Option, auch auf Geld als Faktor für ein „gutes Familienleben“ einzugehen, sollte aber auf jeden Fall vorhanden sein, weil der materielle Mangel ansonsten leicht hätte tabuisiert werden können. Aus diesem Grund wurde in der Logik des Gesellschaftsspiels auf Spielgeld zurückgegriffen.
Literatur
Adamson, P. (2013). Kinderarmut in reichen Ländern – eine Vergleichsstudie. In: H. Bertram (Hrsg.), Reiche, kluge, glückliche Kinder? – Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland (S. 52–65). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
Andresen, S. (2012). Was Kindheit prekär macht und Kinder verletzlich. Theoretische Ansätze und ausgewählte Befunde. In I. Wallmann-Helmer (Hrsg.), Chancengleichheit und „Behinderung“ im Bildungswesen: Gerechtigkeitstheoretische und sonderpädagogische Perspektiven (S. 107–123). Freiburg: Alber.
Andresen, S., & Galic, D. (2015). Kinder – Armut – Familie. Alltagsbewältigung und Wege zu wirksamer Unterstützung. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Bertram, H. (2013). Reiche, kluge, glückliche Kinder? – Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
Bertram, H., & Spieß, C. K. (2012). Fragt die Eltern! Baden-Baden: Nomos.
Bertram, H., & Spieß, C. K. (Hrsg.). (2011). Fragt die Eltern! Ravensburger Elternsurvey. Elterliches Wohlbefinden in Deutschland. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Bohnsack, R. (1989). Generation, Milieu, Geschlecht. Ergebnisse aus Gruppendiskussionen mit Jugendlichen. Opladen: Leske + Budrich.
Bohnsack, R. (2008). Rekonstruktive Sozialforschung: Einführung in qualitative Methoden. Opladen: Leske + Budrich.
Bohnsack, R., & Schäffer, B. (2001). Gruppendiskussionsverfahren. In T. Hug (Hrsg.), Wie kommt Wissenschaft zu ihrem Wissen?: Bd. 2. Einführung in Forschungsmethodik und Forschungspraxis (S. 324–341). Baltmannsweiler: Schneider.
Bohnsack, R., Przyborski, A., & Schäffer, B. (2006). Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis. Opladen: Budrich.
Bradshaw, J., Martorano, B., Natali, L., & Neubourg, C. de. (2013). Children’s subjective well-being in rich countries. Child Indicators Research , 6(4), 619–635.
Deutscher Bundestag (2013). 14. Kinder und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Online: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/122/1712200.pdf. Zugegriffen: 14. Juli 2013.
Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig & Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. (Hrsg.). (2011). Wirksame Wege gestalten für Familien mit geringem Einkommen. Braunschweig: Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig & Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.
Dockett, S. (2013). Transition to school: Normative or relative? In B. Perry, S. Dockett, & A. Petriwskyj (Hrsg.), Transition to school: International research, policy and practice. Dordrecht: Springer.
Duflo, E. (2013). Kampf gegen die Armut. Berlin: Suhrkamp.
Duflo, E., & Banerjee, A. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. New York: Public Affairs.
Easton, C., Featherstone, G., Poet, H., Aston, H., Gee, G., & Durbin, B. (2012). Supporting families with complex needs: Findings from LARC 4. Slough: NFER.
Jurczyk, K., & Klinkhardt, J. (2014). Vater, Mutter, Kind? Acht Trends in Familien, die Politik heute kennen sollte. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Loos, P., & Schäffer, B. (2001). Das Gruppendiskussionsverfahren. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendung. Opladen: Leske + Budrich.
Minkkinen, J. (2013). The structural model of child well-being. Child Indicators Research, 6(3), 547–558.
Nussbaum, M. (1999). Gerechtigkeit oder das gute Leben. Frankfurt a. M: Suhrkamp.
Nussbaum, M. (2000). Women and human development: The capabilities approach. Cambridge: Cambridge University Press.
World Vision e.V. (Hrsg.) (2010). Kinder in Deutschland 2010. 2. World Vision Survey. Wissenschaftliche Leitung: Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag.
World Vision. (2013). Wie gerecht ist unsere Welt? Kinder in Deutschland 2013. 3. World Vision Kinderstudie. Weinheim: Beltz.
Zerle, C., & Keddi, B. (2011). „Doing Care“ im Alltag Vollzeit erwerbstätiger Mütter und Väter. Aktuelle Befunde aus AIDA. GENDER Die Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3(3), 55–72.
Weiterführende Literatur
Andresen, S. (2014a). Just wait and don’t upset yourself: When children are exposed to poverty in their daily lives. In R. N. Emde & M. Leuzinger-Bohleber (Hrsg.), Early parenting and prevention of disorder. Psychoanalytic research at interdisciplinary frontiers (S. 297–309). London: Karnac.
Andresen, S. (2014b). Childhood vulnerability: Systematic, structural, and individual dimension. Child Indicators Research, 7(4), 699–713.
Andresen, S., & Fegter, S. (2009). Spielräume sozial benachteiligter Kinder. Bepanthen Kinderarmutsstudie. Eine ethnographische Studie zu Kinderarmut in Hamburg und Berlin. Leverkusen: Bepanthen-Kinderförderung.
BMFSFJ. (Hrsg.). (2012). Achter Familienbericht. Zeit für Familie – Familienzeitpolitik als Chance einer nachhaltigen Familienpolitik. Drucksache 17/9000. Berlin.
BMFSFJ. (2014). Bildungs- und Teilhabepaket. http://www.mfkjks.nrw.de/familie/finanzielle-hilfe/bildungs-und-teilhabepaket.html. Zugegriffen: 5. Sept. 2014.
Bohnsack, R. (2006). Qualitative Evaluation und Handlungspraxis. Grundlagen dokumentarischer Evaluationsforschung. In U. Flick (Hrsg.), Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzungen (S. 135–158). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., & Nohl, A. M. (2007). Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS.
Gillies, V. (2012). Family policy and the politics of parenting: From function to competence. In M. Richter & S. Andresen (Hrsg.), The politicization of parenthood shifting private and public responsibilities in education and child rearing children’s well-being: Indicators and research (S. 13–27). Dordrecht: Springer.
GOE. (2013). Alleinerziehend in Wolfsburg. http://www.wolfsburg.de/irj/go/km/docs/imperia/mam/portal/gesundheit_und_soziales/pdf/bericht_alleinerziehend_2013.pdf. Zugegriffen: 20. Okt. 2014.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). (2011). Alleinerziehende ALG-II-Empfängerinnen mit kleinen Kindern: Oft in Ein-Euro-Jobs, selten in betrieblichen Maßnahmen. IAB-Kurzbericht, 2011(21), 1–8.
IW. (2014). Einkommensarmut in Deutschland aus regionaler Sicht. Materialien zum Pressestatement, 25.08.2014. Berlin: Institut der deutschen Wirtschaft.
Kleingeld, P., & Anderson, J. (2008). Die gerechtigkeitsorientierte Familie: Jenseits der Spannung zwischen Liebe und Gerechtigkeit. In A. Honneth & B. Rössler (Hrsg.), Person zu Person: Zur Moralität persönlicher Beziehungen (S. 283–312). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press.
Lenze, A. (2014). Alleinerziehende unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reformbedarf. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Lutz, R. (2011). Erschöpfte Familien. Wiesbaden: Springer VS.
Lutz, R. (2014). Ökonomische Landnahme und Verwundbarkeit – Thesen zur Produktion sozialer Ungleichheit. Neue Praxis, 14(1), 3–22.
MFKJKS. (2013). Fachbericht „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“. Düsseldorf: MFKJKS.
Monitor Familienleben. (2012). Einstellungen und Lebensverhältnisse von Familien. Institut für Demoskopie Allensbach. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie. www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/Monitor_Familienleben_2012.pdf. Zugegriffen: 10. Okt. 2014.
Paritätischer Wohlfahrtsverband. (2012). Arme Kinder – arme Eltern. Zahlen, Daten, Fakten. Berlin: Der Paritätische Gesamtverband.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
About this chapter
Cite this chapter
Andresen, S. (2017). Familienarmut und elterliche Erfahrungen. Befunde aus einer qualitativen Studie. In: Baader, M., Freytag, T. (eds) Bildung und Ungleichheit in Deutschland. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14999-4_6
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14999-4_6
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-14998-7
Online ISBN: 978-3-658-14999-4
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)