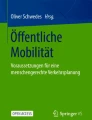Zusammenfassung
Obwohl die ‚Inhalte‘ von Antisemitismus und Antiziganismus divergieren, sind beide eng mit dem Kapitalismus verbunden: antisemitische Phantasmen leben von Bildern, in denen die ‚Juden‘ mit den abstrakten Seiten des Kapitalismus assoziiert werden und ihnen eine Macht zur Weltverschwörung zugesprochen wird. Antiziganistische Phantasmen hingegen identifizieren in dem ‚Zigeuner‘ den ‚Asozialen‘ schlechthin, der von dem Arbeitslohn der anderen schmarotzt. Die Zusammenhänge zwischen Krisendynamik, Antisemitismus und Antiziganismus unter Einbeziehung der Veränderungen und Verschiebungen innerhalb der antisemitischen bzw. antiziganistischen Phantasmen unter dem Eindruck der aktuellen Krisenerscheinungen, die auf die ‚innere Schranke‘ des Kapitalismus verweisen ist Ziel dieses Artikels.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
- 2.
Mehrere Zehntausend Menschen wurden unter der Kategorie ‚Asoziale‘ vernichtet, wobei es sich bei diesen Menschen nicht nur um ‚arische’ ‚Asoziale‘, sondern vor allem um Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma handelte (vgl Schatz und Woeldike 2001, S. 100 f.).
- 3.
Nach Postone (2005) war es dabei nicht zufällig, dass „die biologische Interpretation der abstrakten Seite des Kapitalismus sich an den Juden festmacht“ (ebd., S. 191). Hierfür macht er unter anderem die schon ältere Assoziation ‚Juden = Geld‘ verantwortlich.
- 4.
Im Gegensatz zu Postone betont Robert Kurz (2005a) allerdings die spezifisch deutsche Geschichte. Er konstatiert zwar, dass autoritäre Staatlichkeit im Kontext der Durchsetzung des Fordismus in den meisten westlichen Ländern auf der Tagesordnung stand, reflektiert aber gleichzeitig – ähnlich wie Schatz und Woeldike –, dass es nur in Deutschland zu einer völkischen Aufladung des Staates „als Kultur- und Abstammungs- oder Blutsgemeinschaft“ (ebd., S. 565) gekommen ist.
- 5.
Darüber hinaus kritisiert Scholz (2005), dass Postone „das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus, die Struktur der Abspaltung, außer Betracht läßt“ (ebd., S. 87). Gerade für den Dualismus ‚Abstrakheit – Konkretheit‘ sei dieses Verhältnis aber entscheidend – so Scholz. Im Gegensatz zu Postone geht die Wertabspaltungstheorie nicht von „einem universalistischen Monismus des Werts/der abstrakten Arbeit aus, sondern bezieht sich ebenso auf die abgespaltenen Momente“ (Scholz 2005, S. 87). Es geht also nicht nur um den „Dualismus von Tauschwert – Gebrauchswert der Ware, sondern auch um die gesellschaftlichen Aspekte des Konsums der Gebrauchswerte, wobei der Tauschwert und der selber noch abstrakte Gebrauchswert ökonomische und androzentrische Kategorien sind, während der „Konsum des Gebrauchswerts“ als in einer weiblich konnotierten Sphäre des Privaten […] befindlicher aus der Tauschwert-Gebrauchswert-Dialektik gewissermaßen als terra incognita herausfällt“ (Scholz 2005, S. 87). Diese „‚Konkretheit‘ im Reproduktionsbereich“ (Scholz 2005, S. 87) ist dabei ebenfalls „gesellschaftlich-kapitalistisch vermittelt“ (Scholz 2005, S. 87). Gerade dies verweist auf das basale gesellschaftliche Formprinzip der Dialektik von Wert und Abspaltung.
- 6.
Roswitha Scholz (2005) kritisiert zu Recht, dass Schatz und Woeldike den Gebrauchswert „mit den wirklich konkreten Inhalt“ (ebd., S. 100) gleichsetzen. Die Erscheinungsform des Tauschwerts als Gebrauchswert ist selbst etwas Abstraktes. So kritisiert sie ebenfalls, dass Schatz und Woelidike mit Lukács von einem ‚nicht zu verdinglichen Rest‘ und „insofern eben von ‚Freiheit und Wahn‘ deutscher Arbeit gleichzeitig“ (Scholz 2005, S. 101) ausgehen. Sie schreibt hierzu: „Die Identifizierung mit der (deutschen) Arbeit, dem Inhalt der Arbeit, bedeutet für mich Vollverdinglichung und kann nicht als Ausdruck eines ‚nicht zu verdinglichenden Rests‘ gelten“ (Scholz 2005, S. 101).
- 7.
‚Porrajmos‘ ist die Bezeichnung für die systematische Vernichtung der Sinti und Roma im Faschismus.
- 8.
Die Figur des ‚homo sacer‘ übernimmt Roswitha Scholz von dem Rechtsphilosophen Giorgio Agamben. Nach ihm ist der ‚homo sacer‘ ein Mensch, der zwar nicht geopfert, aber straffrei getötet werden darf (vgl. Agamben 2002). Agamben bringt diese Figur in Verbindung zu dem Lager ‚als Nomos der Moderne‘ und dem Ausnahmezustand. Die Dimension des Lagers, in dem Menschen auf das ‚nackte Leben‘ reduziert werden, und des Ausnahmezustands, der das Verhältnis einer ausschließenden Einschließung mitkonstruiert, sind gerade in Bezug auf den Antiziganismus zentrale Momente, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen kann. Allerdings möchte ich noch darauf verweisen, dass Roswitha Scholz nicht ungebrochen an Agamben anschließt, sondern diesen wegen seiner rein rechtsphilosophischen Bestimmung kritisiert (vgl. hierzu Scholz 2007; 2009).
- 9.
Auf diese Problematik hat nicht zuletzt Ulrich Beck bereits 1986 in seinem Buch Risikogesellschaft aufmerksam gemacht.
Literatur- und Quellenverzeichnis
Agamben, A. (2002). Homo sacer. Die Souveränität der Macht und das nackte Leben. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hund, W. D. (1996). Das Zigeuner-Gen. Rassistische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In W. D. Hund (Hrsg.), Zigeuner. Geschichte und Struktur einer rassistischen Konstruktion (S. 11–35). Duisburg: DISS.
Hund, W. D. (2000). Romantischer Rassismus. Zur Funktion des Zigeunerstereotyps. In W. D. Hund (Hrsg.), Zigeunerbilder. Schnittmuster rassistischer Ideologie (S. 9–30). Duisburg: DISS.
KRISIS. (1999). Manifest gegen die Arbeit. Leverkusen: Eigenverlag.
Kurz, R. (2004). Blutige Vernunft. Essays zur emanzipatorischen Kritik der kapitalisierten Moderne und ihrer westlichen Werte. Bad Honnef: Horlemann.
Kurz, R. (2005a). Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. Frankfurt a. M.: Eichborn Verlag AG.
Kurz, R. (2005b). Das Weltkapital. Globalisierung und innere Schranken des warenproduzierenden Systems. Berlin: Edition TIAMAT (Verlag Klaus Bittermann).
Kurz, R. (2005c). Die Substanz des Kapitals. Abstrakte Arbeit als gesellschaftliche Realmetaphysik und die absolute innere Schranke des Kapitals. Zweiter Teil. Exit! Krise und Kritik der Warengesellschaft, 2, 162–235.
Kurz, R. (2009). Die Kindermörder von Gaza. Eine Operation ‚Gegossenes Blei‘ für die empfindsamen Herzen. Exit! Krise und Kritik der Warengesellschaft, 6, 185–250.
Kurz, R. (2013). Geld und Antisemitismus. In R. Scholz & C. P. Ortlieb (Hrsg.), Weltkrise und Ignoranz. Kapitalismus im Niedergang (S. 68–87). Berlin: Edition TIAMAT (Verlag Klaus Bittermann).
Maciejewski, F. (1996). Elemente des Antiziganismus. In J. Giere (Hrsg.), Die gesellschaftliche Konstruktion des Zigeuners. Zur Genese eines Vorurteils (S. 9–28). Frankfurt a. M.: Campus.
Marx, K. (1890). Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (Bd. 1). MEW 23. Berlin: Karl Dietz Verlag.
Postone, M. (2005). Antisemitismus und Nationalsozialismus. In Initiative kritische Geschichtspolitik (Hrsg.), Deutschland, die Linke und der Holocaust (S. 165–194). Freiburg: ça ira.
Schatz, H. (2004). Arbeit als Herrschaft. Die Krise des Leistungsprinzips und seine neoliberale Rekonstruktion. Münster: Unrast.
Schatz, H., & Woeldike, A. (2001). Freiheit und Wahn deutscher Arbeit. Zur historischen Aktualität einer folgenreichen antisemitischen Projektion. Münster: Unrast.
Scholz, R. (2005). Differenzen der Krise – Krise der Differenzen. Die neue Gesellschaftskritik im globalen Zeitalter und der Zusammenhang von ‚Rasse‘, Klasse, Geschlecht und postmoderner Individualisierung. Bad Honnef: Horlemann.
Scholz, R. (2007). Homo sacer und ‚die Zigeuner‘. Antiziganismus – Überlegungen zu einer wesentlichen und deshalb ‚vergessenen‘ Variante des modernen Rassismus. Exit! Krise und Kritik der Warengesellschaft, 4, 177–227 (Bad Honnef: Horlemann).
Scholz, R. (2009). Antiziganismus und Ausnahmezustand. Der ‚Zigeuner‘ in der Arbeitsgesellschaft. In M. End et al. (Hrsg.), Antiziganistische Zustände (S. 24–40). Münster: Unrast.
Scholz, R. (2011 [2000]). Das Geschlecht des Kapitalismus. Feministische Theorien und die postmoderne Metamorphose des Kapitals. Bad Honnef: Horlemann.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Böttcher, E. (2016). Antisemitismus und Antiziganismus als beständige Krisenideologien der Arbeitsgesellschaft. In: Busch, C., Gehrlein, M., Uhlig, T. (eds) Schiefheilungen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10410-8_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-10410-8_5
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-10409-2
Online ISBN: 978-3-658-10410-8
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)