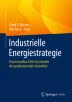Zusammenfassung
Die Liberalisierung der europäischen Energiemärkte der letzten 15 Jahre hatte weitreichende Auswirkungen auf die Energieversorgungsmärkte und folglich auf die Energiebeschaffungskonzepte von Industrieunternehmen. Für die Industrie hat diese neue Marktordnung mit Blick auf ihre Energiebeschaffung weitreichende Konsequenzen. Waren Unternehmen in früheren Jahrzehnten an den örtlichen Energieversorger gebunden, können sie heute ihren Energielieferanten überregional wählen. Die Energieversorger haben sich im Lauf der Jahre auf den wachsenden Wettbewerb mit einem granulareren Produkt‐ und Dienstleistungsangebot eingestellt. Doch mit den Chancen wachsen auch die Risiken für energiebeschaffende Unternehmen. Von Jahr zu Jahr wird der Energieeinkauf komplexer. Bot der Markt in der Vergangenheit überwiegend die klassische Festpreisbeschaffung an, so entwickelten sich bis heute eine Reihe weiterer Produktgruppen mit speziellem Chancen‐Risiko‐Profil.
Mit der politischen Entscheidung zur Energiewende sind die Anbieter und Nachfrager am wettbewerbsintensiven Markt der Energieversorgung mit einem neuen „Game Changer“ konfrontiert. Die neue Marktstruktur hat die Beschaffungsaufgabe von Energieeinkäufern in Industrieunternehmen erheblich verändert. Das Risiko für Industrieunternehmen, in diesem Prozess Beschaffungsentscheidungen ohne vollständigen Informationsüberblick zu tätigen, wird größer. Die Anforderungen an Energieeinkäufer, ihrer Verantwortung für den gesamtheitlichen Unternehmenserfolg gerecht zu werden, wachsen. Vor diesem Hintergrund ist das Thema Energiebeschaffung heute mehr im Fokus von unternehmerischen Entscheidungsprozessen als in der Vergangenheit.
Die auf ein Unternehmensziel abgestimmte individuelle Energiebeschaffungsstrategie ist der Kernpfeiler jeder betriebswirtschaftlichen Energiestrategie.
Für die Energieeinkäufer der Unternehmen gilt es, die vielfältigen Produkte und Anbieter zu kennen und sich gleichzeitig der Risiken von liberalisierten Energiemärkten in Zeiten der Energiewende bewusst zu sein. Altbekannte Marktmechanismen, die Orientierung beim Energieeinkauf boten, gelten in Zeiten von Liberalisierung und Energiewende nicht mehr. Um die betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozesse vor dem Hintergrund der bestehenden Energiemarktstrukturen gestalten zu können, müssen Energieeinkäufer zu folgenden Themen Kompetenzen erwerben:
-
Grundlagenwissen über die deutschen und europäischen Großhandelsmärkte für Energie (Strom und Gas),
-
Risiken, Risikomanagement und Ziele der Energiebeschaffung bei bestehender Marktstruktur,
-
Beschaffungsprodukte im Energieeinkauf,
-
aktuelle politische und volkswirtschaftliche Überlegungen zur Weiterentwicklung der Energiemärkte.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Notes
- 1.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 3).
- 2.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 48 ff.).
- 3.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 3 ff.).
- 4.
Vgl. Wittwer (2008, S. 35).
- 5.
Für eine detaillierte Darstellung der Großhandelsmärkte für Strom und Gas vgl. Kap. 5.
- 6.
Eine Übersicht der typischen Energiebeschaffungsziele von industriellen Sonderkunden erfolgt in Abschn. 19.4.
- 7.
Vgl. Konstantin (2013, S. 72).
- 8.
- 9.
Vgl. Czakainski et al. (2010, S. 21 ff.).
- 10.
Für eine detaillierte Darstellung der Befreiungs‐ und Privilegierungstatbestände vgl. Kap. 8.
- 11.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 84).
- 12.
Für eine detaillierte Darstellung der einzelnen Energiesteuern vgl. Kap. 10.
- 13.
Die Regelenergieumlage wird von den Marktgebietsverantwortlichen erhoben. Ein Industrieunternehmen kann mit dem Energieversorger vereinbaren, dass die Regelenergieumlage im Preis enthalten sein oder separat abgerechnet werden soll. Im Fall der Internalisierung erhöht die Regelenergieumlage in ihrer jeweils aktuellen Fassung den „Nettogaspreis“. Erhöhungen gehen zulasten des Energieversorgers. Wird eine separate Abrechnung vereinbart, hat der Kunde das Risiko einer Erhöhung zu tragen. Eine Anpassung kann alle sechs bis zwölf Monate erfolgen.
- 14.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 8).
- 15.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 8).
- 16.
Vgl. Scholz und Schuler in: Schwintowski (Hrsg.) (2014, S. 540).
- 17.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 9).
- 18.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 72 ff.).
- 19.
Vgl. Wittwer (2008, S. 86 ff.).
- 20.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 73 ff.).
- 21.
Vgl. Scholz und Schuler in: Schwintowski (Hrsg.) (2014, S. 539).
- 22.
Vgl. Wittwer (2008, S. 60).
- 23.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 9).
- 24.
Vgl. Scholz und Schuler in Schwintowski (Hrsg.) (2014, S. 540).
- 25.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 9).
- 26.
Vgl. Wittwer (2008, S. 63 ff.).
- 27.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 9).
- 28.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 135 ff.).
- 29.
Vgl. Wittwer (2008, S. 1 ff.).
- 30.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 135 ff.).
- 31.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 186).
- 32.
Vgl. Konstantin (2013, S. 72 ff.).
- 33.
Ein Bereich, in dem die Verbrauchsreduzierung durch Energieeffizienzmaßnahmen tatsächlich Nachteile im Energiebezug nach sich ziehen kann, ist der Bereich der Befreiungs‐ und Privilegierungstatbestände. Hier gelten für einzelne Abgaben und Umlagen Mindestverbrauchsmengen. Ein Unterschreiten dieser Verbrauchsmengen kann einen Verlust der Befreiung bzw. Privilegierung nach sich ziehen. Bei einem geringen Unterschreiten der Grenzwerte könnte dies zur paradoxen Situation führen, dass eine Verbrauchsreduzierung in erhöhten Energiebezugskosten resultiert.
- 34.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 24 ff.).
- 35.
Vgl. Wittwer (2008, S. 59).
- 36.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 92 ff.).
- 37.
Vgl. Butterweck et al. (2005, S. 138).
- 38.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 25).
- 39.
Vgl. Spicker in Schwintowski (Hrsg.) (2014, S. 70).
- 40.
Analog den Festpreisprodukten in der Strombeschaffung bezieht sich ein Gasfestpreis auf den „Nettogaspreis“. Steigerungen bei Netzentgelten, Steuern und Abgaben gehen zulasten des Kundenunternehmens.
- 41.
Die am Gasmarkt traditionelle Beschaffungsform der Ölpreisbindung (HEL) wird in diesem Beitrag nicht dargestellt. Aufgrund der Entwicklung von liquiden Großhandelsmärkten durch die Liberalisierung hat diese Form der Gasbeschaffung in den letzten Jahren für Industrieunternehmen erheblich an Bedeutung verloren und spielt nur noch eine vernachlässigbare Rolle unter den Beschaffungsprodukten. Moderne Beschaffungsprodukte bieten gegenüber der relativ unflexiblen Gasbeschaffung mit Ölpreisbindung im liberalisierten Gasmarkt für Industrieunternehmen deutlich mehr Handlungschancen. Die Ölpreisbindung ist daher nicht mehr zeitgemäß und in der Gasbeschaffung von Industrieunternehmen eher als „Überbleibsel der alten Gaswelt“ zu sehen.
- 42.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 38).
- 43.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 74).
- 44.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 25).
- 45.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 75).
- 46.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 77).
- 47.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 26).
- 48.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 102).
- 49.
Vgl. Würfel (2014, S. 140 ff.).
- 50.
Vgl. Wittwer (2008, S. 60).
- 51.
Vgl. Wittwer (2008, S. 61 ff.).
- 52.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 61 ff.).
- 53.
Vgl. Wittwer (2008, S. 62).
- 54.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 25).
- 55.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 61 ff.).
- 56.
Vgl. Butterweck et al. (2005, S. 138).
- 57.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 61 ff.).
- 58.
Vgl. Spicker in: Schwintowski (Hrsg.) (2014, S. 76 ff.).
- 59.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 91).
- 60.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 92).
- 61.
Für das Jahresprodukt Cal 2012 (Referenzprodukt Baseload) lag der durchschnittliche Spotpreis bei 42,6 Euro/MWh. Der durchschnittliche Preis des gehandelten Terminmarktproduktes lag bei 56,03 Euro/MWh. 2013 lag der durchschnittliche Spotpreis bei 37,7 Euro/MWh und der durchschnittliche Terminmarktpreis bei 49,4 Euro/MWh. 2014 liegt der Spotpreisdurchschnitt bei 33,12 Euro/MWh und der Terminmarktdurchschnitt bei 39,13 Euro/MWh. Im Vergleich zu Vorjahren verringert sich der absolute Spread zwischen Termin‐ und Spotmarkt, was ein Indikator dafür ist, dass der Terminmarkt den Ausbau der erneuerbaren Energien sukzessive eingepreist hat.
- 62.
Vgl. Würfel (2014, S. 128).
- 63.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 93).
- 64.
Vgl. Würfel und Kunzelmann (2014, S. 16 ff.).
- 65.
Vgl. Wittwer (2008, S. 70).
- 66.
Vgl. Würfel und Kunzelmann (2014, S. 16 ff.).
- 67.
Damit reduziert der Kunde die Aufschläge für Strukturierung der Terminprodukte und trägt diese Risiken selbst. Diese Strategie eignet sich insbesondere für Kunden mit hoher Grundlast über das ganze Jahr.
- 68.
Vgl. Schumacher und Würfel (2015, S. 95 ff.).
- 69.
Vgl. Konstantin (2013, S. 72 ff.).
- 70.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 29 ff.).
- 71.
Vgl. Wittwer (2008, S. 62).
- 72.
Bilanzausgleich bedeutet, dass innerhalb einer Regelzone die Spannung und Frequenz durch den Netzbetreiber stabil gehalten werden müssen. Schwankungen können sich durch fehlerhafte Fahrpläne ergeben. Die Frequenzhaltung erfolgt durch Ausgleichseinspeisungen bzw. Entnahmen. Die Kosten für diese Maßnahmen sind vom Verursacher zu tragen.
- 73.
Vgl. Berg und Borchert (2012, S. 30).
- 74.
Vgl. Wittwer (2008, S. 63).
- 75.
Vgl. Wittwer (2008, S. 64 ff.).
- 76.
Vgl. Spicker in: Schwintowski (Hrsg.) (2014, S. 70).
- 77.
Vgl. Würfel (2014, S. 168).
- 78.
Für eine detaillierte Darstellung der technologischen Aspekte vgl. Kap. 7.
- 79.
Vgl. Wittwer (2008, S. 71 ff.).
- 80.
Vgl. Wittwer (2008, S. 72).
- 81.
Für eine detaillierte Darstellung der Chancen der Teilnahme von Industrieunternehmen am Regelenergiemarkt vgl. Kap. 14.
- 82.
Vgl. Würfel (2014, S. 6).
- 83.
Für eine detaillierte Darstellung der Diskussion um eine Änderung des Strommarktdesigns vgl. Kap. 6.
- 84.
Vgl. Würfel (2014, S. 13 ff.)
- 85.
Der Effekt von fallenden Großhandelspreisen durch einen Kapazitätsmarkt bzw. Kapazitätsmechanismus steht in Wechselwirkung mit der Preis‐ und Margenstrategie der Erzeuger. Er kann daher unterschiedlich stark ausfallen und ist nur schwer zu prognostizieren.
- 86.
- 87.
Literatur
Verwendete Literatur
Berg, M., & Borchert, S. (2012). Strategischer Energieeinkauf, 3. Auflage, Frankfurt: Bundesverband Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik e.V.
Butterweck, Woitkowski und Dudenhausen. Strombeschaffung in einem volatilen Marktumfeld, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 3/2005
Czakainski, M., Lamprecht, F., & Rosen, M. (2010). Energiehandel und Energiemärkte (1. Aufl.). Essen: etv Verlag.
Panos, K. (2013). Praxishandbuch Energiewirtschaft (3. Aufl.). Stuttgart: Springer Vieweg.
Schumacher, I., & Würfel, P. (2015). Strategien zur Strombeschaffung in Unternehmen (1. Aufl.). Mannheim: Springer Gabler.
Schwintowski, H.-P. (2014). Handbuch Energiehandel (3. Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Wittwer, M. (2008). Der deutsche Strommarkt und die ökonomische Beschaffung von Strom in energieintensiven Industrieunternehmen (1. Aufl.). Kiel: Grin Verlag.
Würfel, P. (2014). Unter Strom (1. Aufl.). Mannheim: Springer Spektrum.
Weiterführende Literatur
European Energy Exchange, Leipzig Produktbroschüren über Strom und Gas, Emissionsberechtigungen, Kohle, Download 2014.
Würfel, P., & Kunzelmann, T. (2014). Stromschnäppchen am Spotmarkt sichern. Energy 2.0-Zukunft Energie, 2014(8), 16 ff.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Würfel, P., Kunzelmann, T., Toptik, M. (2017). Energiebeschaffung für Industrieunternehmen. In: Matzen, F., Tesch, R. (eds) Industrielle Energiestrategie. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07606-1_19
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-07606-1_19
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-07605-4
Online ISBN: 978-3-658-07606-1
eBook Packages: Business and Economics (German Language)