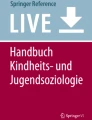Zusammenfassung
In Hinblick auf eine alltagsweltliche Bekanntheit unterscheidet sich das Leben schwerkranker Erwachsener und schwerkranker Kinder nicht. Beide sind in der gesellschaftlichen Wahrnehmung marginalisiert. Worin aber unterscheiden sich die biografischen Situationen von schwerkranken Erwachsenen und Kindern, worin ihre leibkörperlichen Fragilitätserfahrungen bzw. schweren Krankheitserfahrungen?
Zunächst werden die Veränderungen in der Medizin dargestellt, die zu neuen Gruppen kindlicher Patienten geführt haben: Kinder, die, um leben zu können, von Anfang an von medizinischen Maßnahmen abhängig sind. Anschließend werden drei Aspekte diskutiert, die für diese Kinder, ihre Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung durch nahe stehende Personen (Eltern, Geschwister, Freunde) und für ihre Kindheit spezifisch sind: die neuartigen Entwicklungsverläufe und Verlaufskurven, die Form des (Mit)Betroffenseins und das Selbstverstehen als Differenzerfahrung sowie das Fremdverstehen im Modus des Bezeugens, der Zeugenschaft.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
DFG-Projekt „Sozialisationstheoretische Untersuchung zur sozialisatorischen Wirkung von Krankheitserfahrungen bei chronisch schwer kranken Kindern und ihren Eltern“, Laufzeit: 2012–2017 (kostenneutral verlängert).
- 2.
Eine Atemkanüle, die nach einem Luftröhrenschnitt (dauerhaft) eingesetzt wird. Das Kind lernt oft mit dieser Kanüle sprechen, wobei alternative sprachmotorische Anpassungen nötig sind und weitere nicht wenig einschränkende alltägliche Anpassungen die Folge sind.
- 3.
Bei Frühgeborenen treten oft als Folgesymptom der intensivmedizinischen Behandlung morphologische Veränderungen der Gehirnstrukturen auf, die ein selbständiges Abfließen des Liquors verhindern. Der so entstehende Hydrocephalus wird behandelt, indem bleibend ein Shuntsystem intrakorporal eingesetzt wird, der den Liquor in das Körperinnere abgeleitet. Durch das körperliche Wachstum der Kinder müssen diese Shuntsysteme regelmäßig angepasst und „verlängert“ werden. (Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Cerebralshunt).
- 4.
Hörprothese für Gehörlose, deren Hörnerv nicht funktionsgestört ist, z. T. intrakorporal implantiert.
- 5.
Eine Marknagelung, die bei Kindern mit Osteogenesis imperfecta in den Röhrenknochen der Arme und Beine zumeist etwa im Alter zwischen 2 und 3 Jahren eingesetzt werden, als prophylaktische Maßnahme, um bei den i. d. R. hundertfachen (unvermeidlichen) Knochenbrüchen im Laufe des Lebens eine massive Verschiebung der Knochen zu vermeiden. Diese operative Behandlung ist eine große Strapaze für diese Kleinkinder: die schrittweise durchgeführten Operationen gehen mit massiven Schmerzen und temporären Rückschritten der motorischen Entwicklung einher, sind aber eine der drei Grundsäulen der symptomatischen Behandlung dieser unheilbaren Krankheit. Die Teleskopnägel ziehen sich dann beim Wachstum der Knochen allmählich auseinander.
- 6.
Wie aus der Kultursoziologie der Gefühle bekannt, haben auch Gefühlskulturen soziohistorische Bedingungen des Entstehens. Darüberhinaus ist es kein Zufall, dass die Kinderheilkunde selbst ein Produkt des bürgerlichen Zeitalters bzw. ein Erbe der Aufklärung ist und sich mit der Überzeugung durchsetzte, dass Kinder als Patienten aus eigenem Recht in Abgrenzung zu den erwachsenen Patienten anzusehen sind (Peter 2014).
- 7.
- 8.
Das war nicht immer so. Noch in den 1950er-Jahren diskutierte man in der internationalen Forschungsliteratur, ob die (behinderten) Kinder besser zu Hause (Homecare) oder in spezialisierten Einrichtungen aufgehoben sind.
Literatur
Angehrn, E. (2014). Grenzerfahrungen des Menschlichen: psychisches Leiden als Herausforderung der Philosophie. Swiss Archives of Neurology and Psychiatry, 165(4), 106–110. http://www.sanp.ch/docs/sanp/2014/04/en/sanp-00248.pdf. Zugegriffen am 03.01.2016.
Balzer, B., & Rolli, S. (1975). Sozialtherapie mit Eltern Behinderter. Weinheim: Beltz.
Bury, M. (2009 [1982]). Chronische Krankheit als biografischer Bruch. In D. Schaeffer (Hrsg.), Bewältigung chronischer Krankheit im Lebenslauf (S. 75–90). Bern: Huber Verlag.
Corbin, J., & Strauss, A. (1993). Kap. 6. Krankheit, Biographie und Alltag in ein Gleichgewicht bringen. In J Corbin & A Strauss (Hrsg.), Weiterleben lernen. Chronische Kranke in der Familie (S. 76–104). München: Piper.
Corbin, J., & Strauss, A. (1985). Managing chronic illness at home: Three lines of work. Qualitative Sociology, 8(3), 224–247.
Corbin, J., Hildenbrand, B., & Schaeffer, D. (2009). Das Trajektkonzept. In D. Schaeffer (Hrsg.), Bewältigung chronischer Krankheit im Lebenslauf (S. 55–74). Bern: Huber.
Feith, D., & Marquardt, B. ( 2017). Ungewisse Zukünfte am Lebensbeginn. Die soziale Konstruktion eines Kindes unter den Bedingungen einer pränatal diagnostizierten Fehlbildung. In Tsantsa. Zeitschrift der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG), Nr. 22/2017 (Dossier „Ungewisse Zukünfte“). (i. E.)
Flitner, E. et al. (Hrsg.). (2014). Chronisch kranke Kinder in der Schule. Stuttgart: Kohlhammer.
Fuchs, T. (2008). Existentielle Vulnerabilität. Ansätze zu einer Psychopathologie der Grenzsituationen. In S. Rinofer-Kreidl & H. A. Wiltsche (Hrsg.), Karl Jaspers’ Allgemeine Psychopathologie zwischen Wissenschaft, Philosophie und Praxis (S. 95–107). Würzburg: Königshausen & Neumann.
Grathoff, R. (1995). Über Typik und Normalität im alltäglichen Milieu. In R. Grathoff (Hrsg.), Milieu und Lebenswelt. Einführung in die phänomenologische Soziologie und die sozialphänomenologische Forschung (S. 338–358). Frankfurt: Suhrkamp.
Grundmann, M. (2006). Sozialisation. Skizze einer allgemeinen Theorie (UTB, S. 30–54). Konstanz: UVK.
Hengst, H. (2013). Kindheit im 21. Jahrhundert. Differenzielle Zeitgenossenschaft. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
Hildenbrand, B., & Peter, C. (2002). Familiengeschichtliche Gespräche zur Rekonstruktion der Entwicklungsdynamik von Krankheiten. In D. Schaeffer & G. Müller-Mundt (Hrsg.), Qualitative Gesundheits- und Pflegeforschung (S. 247–268). Bern: Huber.
Hitzler, R., & Honer, A. (1984). Lebenswelt – Milieu – Situation. Terminologische Vorschläge zur theoretischen Verständigung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), 36(1), 65–74.
Jaspers, K. (1956). Grenzsituationen. In K Jaspers (Hrsg.), Philosophie. II. Existenzerhellung (S. 201–254). Berlin/Heidelberg: Springer.
Niethammer, D. (2008). Das sprachlose Kind. Vom ehrlichen Umgang mit schwer kranken und sterbenden Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Schattauer.
Niethammer, D. (2010). Wenn ein Kind schwer krank ist. Über den Umgang mit der Wahrheit. Berlin: Suhrkamp.
Noeker, M., & Haverkamp, F. (1997). Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Entwicklung einer Typologie und Zuordnung spezifischer pädiatrisch-psychologischer Interventionskonzepte. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 145, 387–394.
Peter, C. (2006). Dicke Kinder. Fallrekonstruktionen zum sozialen Sinn der juvenilen Dickleibigkeit. Bern: Huber.
Peter, C. (2013). Ungewissheiten in der ‚Ankunft‘ eines frühgeborenen Kindes. Wahrnehmungen der Beteiligten. In C. Peter & D. Funcke (Hrsg.), Wissen an der Grenze. Zum Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit in der modernen Medizin (S. 459–507). Frankfurt: Campus.
Peter, C. (2014). Historische Erziehungskonzepte der Pädiatrie. Wie sich die Pädiatrie seit ihrem Entstehen Gedanken über Erziehung von Kindern macht. In E. Flitner et al. (Hrsg.), Chronisch kranke Kinder in der Schule (S. 82–108). Stuttgart: Kohlhammer.
Peter, C. (2016). Forschungssituationen als forschend-erspürende Situationen? Zu situativen Möglichkeiten, als Forscherin sensible Daten zu erhalten. In R. Hitzler, S. Kreher, A. Poferl & N. Schröer (Hrsg.), Old School – New School? Zur Frage der Optimierung ethnographischer Datengenerierung. Essen: oldib, 2015.
Peter, C., & Richter, M. (2009). Chronische Erkrankungen und Beeinträchtigungen im Kindes- und Jugendalter. In D. Schaeffer (Hrsg.), Bewältigung chronischer Krankheit im Lebenslauf (S. 297–319). Bern: Huber.
Peter, C., & Scheid, C. (2014). Zur Existentialität von Krankheitserfahrungen. Wie eine schwere andauernde Erkrankung des Kindes zur Grenzerfahrung für die Eltern werden kann. In E. Flitner et al. (Hrsg.), Chronisch kranke Kinder in der Schule (S. 26–52). Stuttgart: Kohlhammer.
Redegeld, M. (2004). Lebensqualität chronisch kranker Kinder und Jugendlicher. Eltern- versus Kinderperspektive (Schriftenreihe: Studien zur Kindheits- und Jugendforschung, 35). Hamburg: Kovač.
Rehbock, T. (2014). Grenzsituationen: Ihre philosophische Bedeutung, erläutert am Beispiel der Krankheit. In T. S. Hoffmann (Hrsg.), Grundbegriffe des Praktischen (S. 105–129). Freiburg/München: Alber.
Rosa, H. (2016). Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp.
Schütz, A., & Luckmann, T. (2003). Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UVK.
Youniss, J. (1994). Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung. Frankfurt: Suhrkamp.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Peter, C. (2018). Kindheit unter Krankheitsbedingungen. In: Lange, A., Reiter, H., Schutter, S., Steiner, C. (eds) Handbuch Kindheits- und Jugendsoziologie. Springer Reference Sozialwissenschaften. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04207-3_47
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-04207-3_47
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-04206-6
Online ISBN: 978-3-658-04207-3
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)