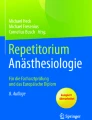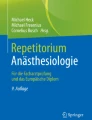Zusammenfassung
Ein Abfall der Körperkerntemperatur <35 °C wird als Hypothermie bezeichnet. Risikosituationen zur Entstehung einer Hypothermie sind die Neugeborenenperiode (bei Reanimationen im Kreißsaal, bei schwerer Sepsis und perioperativ), Intoxikationen (Alkohol, Barbiturate u. a.), Kindesmisshandlungen, (Ertrinkungs-)unfälle in den Wintermonaten oder im Gebirge. Von der globalen Hypothermie müssen lokale Erfrierungen (Ohren, Nase, Finger und Zehen) abgegrenzt werden, welche bei Normo- oder Hypothermie des Körperkerns auftreten können und auf welche in diesem Rahmen nicht eingegangen wird.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Definition und Umstände
Ein Abfall der Körperkerntemperatur <35 °C wird als Hypothermie bezeichnet. Risikosituationen zur Entstehung einer Hypothermie sind die Neugeborenenperiode (bei Reanimationen im Kreißsaal, bei schwerer Sepsis und perioperativ), Intoxikationen (Alkohol, Barbiturate u. a.), Kindesmisshandlungen, (Ertrinkungs-)unfälle in den Wintermonaten oder im Gebirge. Von der globalen Hypothermie müssen lokale Erfrierungen (Ohren, Nase, Finger und Zehen) abgegrenzt werden, welche bei Normo- oder Hypothermie des Körperkerns auftreten können und auf welche in diesem Rahmen nicht eingegangen wird.
Pathophysiologie und Klinik
Wärmeverluste finden aufgrund von Konvektion (Wind), Konduktion (direkter Kontakt mit kaltem Wasser) und Evaporation (nasse Haut oder Kleider) statt. Das folgende Absinken der Körperkerntemperatur löst eine Reihe von physiologischen Reaktionen aus. Der hypothalamische Thermostat registriert den Temperaturabfall und aktiviert das sympathische Nervensystem, wodurch der Muskeltonus bis zum Muskelzittern (shivering) und Stoffwechselaktivität gesteigert werden. Gleichzeitig kommt es zu einer ausgeprägten kutanen Vasokonstriktion. Falls die homöostatischen Mechanismen die Wärmeverluste nicht mehr kompensieren können, sinkt die Körperkerntemperatur. Beim Abfall von 35 °C bis 32 °C wird ein Exzitationsstadium durchlaufen, in dem der Organismus durch vermehrte Wärmeproduktion und kutane Vasokonstriktion die Kerntemperatur zu steigern versucht. Unter 32 °C werden Organ-/Systemfunktionen verlangsamt, und der Sauerstoffverbrauch sinkt drastisch (bei 28 °C beträgt der Sauerstoffverbrauch noch 50 %, bei 18 °C 22 % der Normalwerte bei 37 °C). Atrioventrikuläre Überleitungsstörungen und Arrhythmien treten in der Regel ab 30 °C auf, und unter 26 °C ist mit Kammerflimmern zu rechnen. Durch Flüssigkeitsverschiebungen ins Interstitium und Kältediurese entsteht eine Hypovolämie.
Unter 32 °C schränkt sich die Bewusstseinslage ein und macht einem Verwirrtheitszustand Platz, unter 30 °C wird das Individuum komatös, eine bilaterale areaktive Mydriasis folgt, und bei 24 °C kommt es meist zum Atmungsstillstand. In der Hypothermie gerinnt das Blut nicht mehr normal (In-vivo-Kältekoagulopathie ), und durch die erwähnten Flüssigkeitsverluste steigt der Hämatokrit.
Therapie
Die Bergung von Opfern mit Hypothermie muss sehr sorgfältig geschehen, da durch den Einstrom von kaltem Blut aus der Körperperipherie ein Kammerflimmern ausgelöst werden kann. Der Patient sollte dann möglichst rasch in eine warme, windgeschützte und trockene Umgebung gebracht werden. Bei erhaltendem Bewusstsein können warme Getränke verabreicht werden. Im Fall von Koma und Bradypnoe sollten die Atemwege mit einem Trachealtubus gesichert und die Atmung mechanisch unterstützt, beim Vorliegen einer Asystolie oder eines Kammerflimmerns (Diagnose mithilfe eines Elektrokardiogramms) mit äußerer Herzmassage begonnen werden. Der Volumenersatz wird mit isotonen Lösungen in Form von NaCl 0,9 % bzw. Ringer-Laktat durchgeführt.
Anlässlich der Notfallaufnahme kann meist erst mit einem Spezialthermometer die Temperatur korrekt festgestellt werden. Bei Patienten mit Temperaturen über 32 °C genügen in der Regel einfache Maßnahmen zum Wiederaufwärmen (warme Getränke, warme Decken u. a.). Schwieriger ist die Situation bei Temperatur unter 30 °C mit Koma, instabiler Atmung und gestörter Kreislauffunktion. Hier muss alles daran gesetzt werden, die Temperatur durch aktives Aufwärmen in einen Bereich von 32–34 °C zu bringen (Beatmung mit warmen und angefeuchteten Gasen, Zufuhr von warmer, isotoner NaCl-Lösung bzw. Ringer-Laktat, Peritoneal- und Magenspülungen mit warmen Spüllösungen, Wärmestrahler, Wärmematratze, Warmluftgebläse). Die Temperatur der zugeführten Gase oder Flüssigkeiten sollten 42 °C nicht überschreiten, lokale Wärmeapplikation (Bettflaschen u. a.) kann leicht zu Verbrennungen führen. In der Phase des Aufwärmens können Ösophagus- und Rektaltemperatur um 2–3 °C differieren, in der Regel wird die Kontrolle der Ösophagustemperatur vorgezogen, da sie ein rasch reagierendes Kompartiment repräsentiert.
Bei größeren Kindern (>25 kg Körpergewicht) mit tiefer Hypothermie (<25 °C) und Kreislaufstillstand steht als Alternative das Aufwärmen mittels Herz-Lungen-Maschine in einem Herzzentrum zur Diskussion (cave: meist Vollheparinisierung notwendig).
Welche Technik des Aufwärmens auch immer angewandt wird, das Aufwärmen muss wegen der Möglichkeit eines Scheintodes immer bis zum Erreichen von 30–32 °C fortgeführt werden. Erst zu diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll, Rhythmusstörungen (Kammerflimmern) zu behandeln, und auch erst dann kann über eine Weiterführung bzw. den Abbruch einer kardiopulmonalen Reanimation entschieden werden („no one is dead, unless warm and dead“). In wirklich desolaten Fällen mit tiefer Hypothermie, Apnoe und Kreislaufstillstand, welche durch eine prolongierte Hypoxie kompliziert sind (Ertrinkungs- und Lawinenunfälle), kann bei Krankenhauseintritt aufgrund von wenigen Laborwerten die Gesamtsituation mehr oder weniger zuverlässig beurteilt werden. Bei einem pH <6,5, einem Serumkalium >10 mmol/l und einer schweren Koagulopathie darf eine Reanimation ohne Erreichen von 32–34 °C Kerntemperatur abgebrochen werden.
Literatur
Bernard SA (2003) Induced hypothermia in critical care medicine: a review. Crit Care Med 31:2041–2051
Larach MG (1995) Accidental hypothermia. Lancet 345:493–498
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Wagner, B.P. (2014). Akzidentelle Hypothermie. In: Hoffmann, G., Lentze, M., Spranger, J., Zepp, F. (eds) Pädiatrie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41866-2_108
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-41866-2_108
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-41865-5
Online ISBN: 978-3-642-41866-2
eBook Packages: Medicine (German Language)